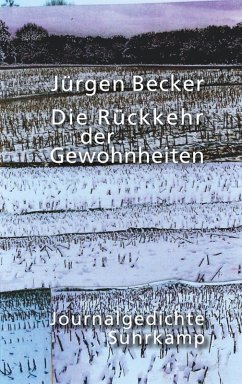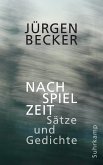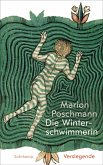Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Sachliche Melancholie: Jürgen Beckers "Gesammelte Gedichte" und der neue Band "Die Rückkehr der Gewohnheiten"
Irgendwo steht bei Jürgen Becker immer ein Kübelwagen herum. Manchmal auch ein Jeep, ein Hanomag. Der Unimog erscheint gar als "mächtiger Käfer im Hohlweg". Ein Tesla wurde dagegen in der Lyrik des Büchnerpreisträgers, der am 10. Juli seinen 90. Geburtstag feiert, noch nicht gesichtet. Es sind eher die geländegängigen Fahrzeuge, die es in Beckers Verse schaffen, nicht die schnittigen Straßenkreuzer. Wobei die Autobahn nah vorbeiführt an Beckers Wohnort im Bergischen Land. Vor allem nachts dringt sie ins Bewusstsein, da rauscht sie in der Ferne als Meer.
Wer in Jürgen Beckers Gedichten unterwegs ist, braucht keine Sorge zu haben, dass ihm der Sprit ausgeht: An jeder Ecke steht eine Tankstelle. Sogar in den Titel des Bandes "Dorfrand mit Tankstelle" von 2007 hat es diese Institution der mobilen Welt geschafft, samt Tankwart versteht sich, und Moritz, der Tankwart, heißt es da, "weiß Bescheid". Auch zehn Jahre später, in Beckers Langgedicht "Graugänse über Toronto", taucht er dann wieder auf: "Putins Rache, weiß der Tankwart, er liefert / dem Westen den Winter nicht mehr / Minusgrade wie im / Krieg, Skispuren quer durch den Kiefernwald, Reisig im Rucksack, / tot der Hund und starr wie ein Brett".
Aber die Zeiten ändern sich, Putins Rache besteht jetzt darin, dass er statt des Winters das Gas zurückhält, und an den Tankstellen begegnet man keinem Tankwart mehr, stattdessen sitzt ein Mädchen hinter Plexiglas, und "es kann / nur die Kasse". So heißt es im jüngsten, nun zeitgleich mit den "Gesammelten Gedichten" erschienenen Band "Die Rückkehr der Gewohnheiten".
Journalgedichte nennt Becker seine neuen Texte, und das sind sie auf ihre Art: lyrische Mitschriften des Tages und jener Bewusstseinszustände, in denen das Impfen, die "Falten im Gesicht / von Caroline Peters" und die Erinnerung an den Krieg zueinanderfinden. Wobei: Es sind nicht wirklich Erinnerungen. Der Krieg und die Nachkriegsjahre, die frühe Bundesrepublik mit ihren Borgwards und DKWs sind in Beckers Gedichten genauso gegenwärtig wie Twitter, Google und jene inzwischen freilich auch schon eingestellte "Eifel-Serie" um die Kommissarin Sophie Haas.
Gestern und heute sind in Beckers Gedichten nicht klar geschieden, sie fließen ineinander über, es sind Dämmerungsgedichte, in denen die Ränder verwischen und ausfransen und sich die Dinge überlagern. "Es zieht / an diesem Nachmittag ein paar Jahrzehnte / zusammen" heißt es im Band "Journal der Wiederholungen" von 1999.
Becker ist ein Autor, der mit Rekombinationen arbeitet, dem "Geräusch der Korrespondenzen" nachlauscht, der ein "Rätselnetz der Motive" auswirft: Nicht nur das Motivfeld der Automobilität wird aufs immer Neue variiert, auch Regen und Schnee, Kirschbäume und Platanen sind Konstanten dieser Gedichtwelt. Dabei gelingt es ihm seit über einem halben Jahrhundert, seit seinem ersten Gedichtband "Schnee" von 1971, bei aller Treue zum im Grunde sehr überschaubaren eigenen Repertoire, immer frisch und anders zu klingen. Er ist ein DJ seines eigenen Materials, der sein Publikum niemals langweilt, ein Collagist und Montagekünstler, dem es stets gelingt konzise Sprach-, Denk- und Wahrnehmungsbilder zu entwerfen. Ein Wiederholungskünstler, der sich nie selbst kopiert.
Vielleicht hängt das damit zusammen, dass Becker ganz offensichtlich aus dem eigenen Erleben schöpft, eine "Küchentisch-Chronik" verfasst, deren Ort genau zu lokalisieren ist, dass er aber selten "ich" sagt. Seine Lyrik mag persönlich sein, sie gleitet niemals ins bloß Private ab. Auf diese "Dezenz" Jürgen Beckers weist Marion Poschmann in ihrem wunderbaren Nachwort zu den "Gesammelten Gedichten" hin. Darin schreibt sie auch, dass man Beckers tausendseitiges lyrisches Gesamtwerk als "ein großes Poem" lesen kann, womit sie sicher recht hat. Dabei klingt der frühe Becker durchaus etwas anders als der mittlere und der späte, denn es musste ja überhaupt erst mal das Rätselnetz der Motive geknüpft, es mussten die Themen und Gegenstände etabliert, die Ähnlichkeiten in Schwingung versetzt werden, damit das Geräusch der Korrespondenzen hörbar werden konnte.
Es gibt keine Reime in Beckers Gedichten, keine Träume und abgesehen vom Käfer im Hohlweg kaum je eine Metapher. Und obwohl alle diese Ingredienzen herkömmlicher Lyrik fehlen, obwohl die Natur hier eine menschengemachte, von der Menschenwelt durchsetzte ("Kiefernwald, Artillerie") und keine schöne ist, sind diese Gedichte von einer ganz eigenen und ganz eigenartigen Schönheit, einer die etwas mit dem Ton zu tun hat, der sich am ehesten mit "sachliche Melancholie" beschreiben lässt.
Dass die Geschichte keinen Fortschritt kennt, aber konstante Veränderung, von diesem Paradox erzählt Becker immer wieder: "Gestern ist noch immer heute, und wir fangen nicht von vorn an", heißt es in "Dorfrand mit Tankstelle", und andersrum gewendet: "Man fängt von vorn an, auch wenn man alles schon hinter sich hat" ("Graugänse über Toronto"). So kommt einem jene "Mappe mit Zeichnungen aus der Ukraine", die in Beckers jüngstem Band auftaucht und zweifellos dem Zweiten Weltkrieg entstammt, sehr fern und im selben Moment beängstigend nahe vor.
Es ist also eine Frage der Gleichzeitigkeiten. Möge Jürgen Becker sie noch möglichst lange und mit der ihm eigenen Ironie stellen: "Unsichtbar, tief im Geäst, uhuut / der Uhu; nachts kommt der Surrealismus zurück; / man muß noch zum Bahnhof, es gibt keinen Bahnhof; / dies hier ist die Regentonne, und wirklich, / es regnet ja auch." TOBIAS LEHMKUHL
Jürgen Becker: "Gesammelte Gedichte".
Suhrkamp Verlag, Berlin 2022. 1120 S., 78,- Euro.
Jürgen Becker: "Die Rückkehr der Gewohnheiten".
Suhrkamp Verlag, Berlin 2022. 80 S., br., 20,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main