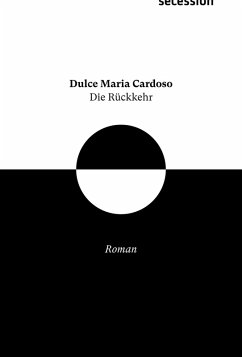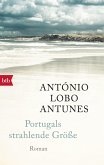Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Von Angola nach Portugal: In ihrem Roman "Die Rückkehr" erzählt Dulce Maria Cardoso von einer Flucht aus der Kolonie.
Die Macht des Vaters überdauert. Der Junge spürt sie noch lange nach seinem Verschwinden, auch im fremden Land, in dem die Mutter, die Schwester und er Zuflucht gefunden haben. Seine Abwesenheit überstrahlt den Alltag der Familie, der kein Alltag mehr sein kann, weil alles, was ihn ausmachte, von den bestickten Tischdecken und bis zur roten Erde, verloren ist. Wieder und wieder kehrt der Junge zurück zu dem Moment, als der Vater, der immer alles im Griff hatte, die Kontrolle verlor, als Soldaten der Befreiungsarmee vor der Tür standen statt des Onkels, der die Familie zum Flughafen bringen sollte, und er die Pistole in einem letzten Versuch, die Seinen zu schützen, in der Tasche verbarg. Der Junge sieht den Schweiß auf dem Hemd des Vaters, hört dessen Lachen, das kein selbstbestimmtes Lachen mehr war. Dann fahren sie mit dem Vater davon.
Der Junge ist mit der Familie nach Portugal gekommen, ins Mutterland, wie er es nennt, weil die Mutter dort geboren ist und er nicht mehr mit ihm verbindet als die schwarzweißen Fotografien hübscher Mädchen aus den Erinnerungsalben. Mädchen mit Kirschen an den Ohren, wie es sie in seiner Heimat Angola nicht gibt. In Angola surrte der Ventilator, dort wurde das Fleisch in der Hitze binnen Stunden schlecht, dort waren seine Freunde, sein Hund, die Schule. Nichts davon ist geblieben. Als sie den Vater zurücklassen mussten, als ihn die Soldaten mitnahmen, waren die Häuser der Weißen in der Nachbarschaft längst besetzt, die Freunde und Bekannten geflohen oder getötet.
Der Junge kann nichts dafür, in diese Zeit geboren zu sein, die ihn 1975 mit fünfzehn Jahren seiner Privilegien beraubt. Er kann nichts für seinen Vater, den Kolonisten, der die Schwarzen abfällig "Matumbos" und "Pretalhada" nannte, Dummköpfe und Gesocks, und alles verbrennen wollte, bevor auch nur eines seiner Besitztümer in die Hände der künftigen angolanischen Nation fiele. Er hat die Vorurteile längst aufgesogen, auch die unbewussten, ist mit ihnen herangewachsen: Wenn man einen Jungen auf dem Fußballplatz "Scheiß-Preto", Scheiß-Schwarzer, nennt, ist das doch keine Beleidigung. Wer foult, hat das verdient. Sie haben ihn verprügelt. Danach spielte er nie wieder mit ihnen. Der Junge glaubt, ihn unter den Soldaten, die seinen Vater mitnahmen, wiedererkannt zu haben.
Dulce Maria Cardoso ist 1964 geboren und wuchs in Angola auf, sie gehört zu den angesehensten Schriftstellerinnen Portugals. Am Beginn des Bürgerkriegs kam sie nach Portugal, damals war sie elf. Ihr endlich auf Deutsch übersetzter Roman "Die Rückkehr" handelt von diesen Kindheitserfahrungen, dem Verlust der Heimat, den Rollenkonflikten. Was sie mit Hilfe des Jungen Rui nacherzählt, überraschte bei der Veröffentlichung 2011 auch ihre portugiesischen Leser, so sehr waren die siebziger Jahre im Gedächtnis des Landes von den Ereignissen der Nelkenrevolution vereinnahmt, die Salazars autoritäres Regime beendete, und von der Verarbeitung des Traumas der Diktatur. Die neue, zunächst provisorische Regierung entschied, die verbliebenen Kolonien in die Unabhängigkeit zu entlassen. Was in Guinea-Bissau und Moçambique verhältnismäßig friedlich ablief, war in Angola der Beginn eines jahrzehntelangen Bürgerkriegs, in dem etwa 500 000 Menschen starben und 2,5 Millionen vertrieben wurden - auch viele Angolaner.
Die zwiespältige Rolle Tausender Rückkehrer, die von einem Institut zur Unterstützung der Staatsangehörigen aufgenommen und von Herrschenden zu Geduldeten wurden, von Pionieren zu Ausbeutern, blieb lange unverarbeitet. Inzwischen haben auch andere Autoren eindringlich über ihre Jugend in den Kolonien geschrieben, Isabela Figueiredo etwa, die in Moçambique aufgewachsen ist. Diese von Ressentiments und Selbstbetrug geprägten Familienerfahrungen, ihre inneren Konflikte (für Ruis Vater sind die portugiesischen Soldaten Verräter, für seinen Onkel Zé Helden) und Beobachtungen aus dem Alltag des kolonialistischen Herrschaftssystems werden in Portugal inzwischen heftig diskutiert.
Wie befreit man ein Land aus fünf Jahrhunderten der Unterdrückung? Wem gehört der Besitz der Kolonisten? Ruis Familie ist nicht reich, sein Vater hat zeitlebens hart gearbeitet. Und nun, denkt der Junge nach der Ankunft im Mutterland, das so anders ist, als er es sich vorgestellt hat, nun sollen wir, die alles verloren haben, die Unterdrücker gewesen sein, selbst schuld an unserem Leid? Der nächste Aufstand wird kommen, denkt er. Dann werden sie bei den portugiesischen Moralisten an die Tür klopfen und sie mit gefesselten Händen abführen.
Seine Beobachtungen sind die eines noch kaum der Kindheit entwachsenen Jugendlichen, der mit der neuen Rolle des Familienoberhaupts wenig anfangen kann, der lieber Überlegungen zu den Unterschieden zwischen den jungen Angolanerinnen und den prüden Portugiesinnen anstellt und eine feine Sensorik dafür entwickelt, wie die fremden Landsleute über seine kranke Mutter lästern.
Cardosos Schreiben hat eine lyrisch-metaphorische Qualität, die den Einschnitt in das Leben der Familie mit allen Sinnen spürbar macht. Ein Feldweg aus roter Erde: als läge zufällig gerade dort der Höllengrund. Die Schüsse in der Nachbarschaft, die Familie sprachlos am Tisch. Solange die Zukunft Besserung versprach, gab es beim Essen noch etwas zu besprechen. Nun also Stille. Bei Cardoso mischen sich erlebte Rede und die Stimmen der Menschen aus den Begegnungen, die dem Jungen nicht aus dem Kopf gehen, die Ratschläge des Vaters für die labile Mutter, die Worte der Hoteldirektorin bei ihrer Ankunft: "Ich weiß, dass Sie nicht aus dem Dschungel kommen."
Die Tragik der Geschichte liegt auch darin, dass Ruis Familie nicht in ein gesundes Land flüchtet, sondern in ein von der Revolution ausgezehrtes, ein armes Land, das die Mutter einst in der Erwartung zurückließ, in einem Haus mit Wasserhähnen leben zu dürfen. Ein Land, so klein und unscheinbar, dass Rui einfach nicht versteht, wie es jemals die Rolle des Imperiums für sich beanspruchen konnte. Sein naiver Blick auf das absurde Ringen der Erwachsenen um Bedeutung, ihr Kampf gegen die kollektive Schuld, sein Herauswachsen aus ihren Ressentiments machen Cardosos Roman zu einem drastischen Zeitdokument. Er verstehe nicht, denkt Rui, wie die Rückkehrer darüber streiten können, welches die bessere Kolonie war: "Wenn wir sie doch beide verloren haben."
ELENA WITZECK
Dulce Maria Cardoso: "Die Rückkehr". Roman.
Aus dem Portugiesischen von Steven Uhly. Secession Verlag, Zürich 2021. 255 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main