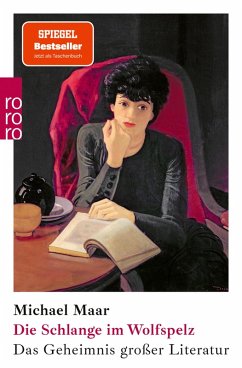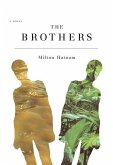Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

In guten wie in schlechten Sätzen: Der Literaturkritiker Michael Maar fragt nach dem Geheimnis guten Stils und nimmt die großen Werke der Weltliteratur in seine Lektorenhand.
Ist es wirklich ein Abenteuerbuch, das der Literaturkritiker und -wissenschaftler Michael Maar da geschrieben hat? Die Geschichte einer Schatzsuche? Vom Einband blickt einem eine elegante junge Frau entgegen, ihr Blick, selbstbewusst, aber verträumt, trifft einen nicht direkt, die Linke liegt auf einem aufgeschlagenen Buch, das seltsam unscharf scheint (sind das verschwommene Zeilen, Bilder hinter Pergamentpapier?), die Rechte stützt nicht, wie man bei flüchtigem Blick vermuten könnte, den leseschwer gewordenen Kopf, sondern deutet eine Faust an - eine Drohgebärde? Dazu, farblich vornehm abgestimmt, der Titel: "Die Schlange im Wolfspelz. Das Geheimnis großer Literatur". Ein nur leicht aufdringlich mysteriöses Gemälde, ein kurios verrutschtes Sprachbild und ein Versprechen, so hochgegriffen, dass man dem Autor sofort zutraut, auf seine Einlösung souverän zu verzichten, zumindest diesen Schatz nicht jagen zu müssen. Welchen aber dann?
Den Begriff, um den das ganze Buch - immerhin 656 Seiten - aufgebaut ist, sucht man in dessen Titel vergebens: Stil. Ein altmodisches Wort, allerdings ist gewaltig Spannung drauf. Stil, das meint das höchst Individuelle eines (in diesem Falle: literarischen) Ausdrucks. Stil behauptet einen Gleichklang von Persönlichkeit und Form, was ziemlich vertrackt ist, nicht nur weil Gleichklang nicht leicht zu haben ist, sondern weil so eine Persönlichkeit ohnehin eine reichlich dissonante Angelegenheit darstellt. Stil bildet die Persönlichkeit nicht ab, er müht sich, sie zusammenzuhalten. Allerdings meint Stil zugleich gerade das Überindividuelle: den Stil einer Schule, einer Zeit (sozusagen den Form gewordenen Zeitgeist) oder eben den "guten" Stil (also das unterliegende Regelwerk, das angeblich nur missachten darf, wer es in- und auswendig kennt). Stil ist individuelle Haltung, die sich nicht nur den Anforderungen einer Gegenwart entgegenwirft, sondern, unverfroren genug, dabei auch die einer komplizierten Vergangenheit und einer offenen Zukunft in Anspruch nimmt. Von da ist man natürlich schnell auf den sprach- und identitätspolitischen Schlacht- und Minenfeldern dieser Tage.
Maar, der sich hütet, sich festzulegen auf eine Definition, was "Stil" sein könnte, hat all das im Blick - das Sozial-Historische, zumal das Politische eher halbherzig. Er ist so frei, ein wenig aus der Zeit zu fallen und sich an die "Großen" zu halten, denn eine Abenteuergeschichte braucht Helden, auch fragwürdige, auch komische, strauchelnde. Maars Helden heißen unter anderem: Walter Benjamin, Rudolf Borchardt, Heimito von Doderer, Johann Wolfgang von Goethe, Franz Kafka, Thomas Mann, Martin Mosebach, Robert Musil, Friedrich Nietzsche, Marcel Proust, Joseph Roth, Arthur Schopenhauer, Rahel Varnhagen - eine ziemliche Männerriege, zumindest in prominenten Nebenrollen gibt es schillernde Frauengestalten: Marie von Ebner-Eschenbach, Marieluise Fleißer, Brigitte Kronauer, Christine Lavant. In regelmäßigen Slapstick-Einlagen: Stefan Zweig. Irgendwie schwierig, zwielichtig, doch das gehört ja auch zu einer guten Story: Hans Henny Jahnn und Arno Schmidt. Die Namensreihe gibt bereits einen guten Eindruck vom literarischen Kosmos, in dem Maars Schatzsuche stattfindet. Es geht klassisch-modern zu. Die Grenzen sind, da es um Sprache geht, ziemlich dicht, immerhin Proust hat ein Schlupfloch gefunden.
Auch die Erzählerfigur, die unter anderem unter dem Titel "Stilkritiker" firmiert, ist dadurch schon recht gut konturiert, stellt sich aber vor allem im ersten Drittel des Buches bereitwillig vor. Auch wenn Maar ausdrücklich kein normatives Regelwerk eines literarisch "guten Stils" aufstellen will (so altmodisch mag er es dann doch nicht haben), schon gar keine literaturtheoretische oder -historische Ableitung von Stilbegriffen, führt er in den ersten drei Kapiteln doch eine ganze Reihe von "Instrumenten" des Stils vor, die zugleich dazu herhalten sollen, die zahlreich ausgebreiteten Beispiele kritisch abzuwägen und zu beurteilen. Und beurteilt wird viel in diesem Buch - in diversen Tonlagen, kollegial-anteilnehmend an guten "Einfällen", unvermeidlichen "Schrullen" und "stilistischen Missgriffen", mit zuckender "Lektorenhand" die "Fehler" unterkringelnd, streng-lehrerhaft, dann wieder amüsiert-gütig die "Kunstfehler" scannend.
So arbeitet er sich vor, vom Einzelwort, das sitzen muss, bis hin zur Figurenrede, die stilisiert, aber, bitte schön, dennoch lebendig und glaubwürdig sein soll. Maars Lieblingsbegriff stammt aus der klassischen Rhetorik - "Aptum", das Angemessene. Nichts gegen Extravaganz, aber bitte mit Maß. Nichts gegen Lautstärke, aber bitte nicht dauerhaft. Nichts gegen ausgefallene Worte, aber bitte nur, wenn es keine schlichten gibt, die dasselbe unaufdringlicher sagen. Nichts gegen überraschende Metaphern, nur ins Grübeln sollte man nicht kommen darüber. Natürlich nichts gegen Adjektive, aber doch bitte nur, wenn sie etwas erzählen, das man nicht eh schon wusste. Nichts - und so weiter. Wobei man angesichts solcher Mahnungen zusammenzucken mag, bei den Beispielen (ob abschreckend oder neidenswert) nickt man dann doch des Öfteren. Sie sind auch suggestiv aufbereitet.
Tatsächlich ist das die größte Stärke des Buchs: Maar versteht es, den Stil einer Autorin, eines Autors, eines Textes, eines Zitats mit wenigen Worten, ohne akademische Herleitungen, ohne Jargon zu charakterisieren. Das klingt dann zum Beispiel so: "Grünbein-typisch ist die Kreuzung des Bildungsschweren - Nymphen, Hesperiden-Saft und Sibyllen - mit der saloppen Formel ,Okay'; indirekt also die Schule Gottfried Benns. Rätselhaft das Namen-Zurückziehen, aber Gedichte dürfen enigmatisch sein. Die Adjektive sind etwas erwartbar; die Nymphe scheu, die Boutique kühl. Der Wald, den man vor schlanken Beinen nicht sieht, leuchtet ein; das Wild mit Gürteln, die den Blick doch kaum ablenken, schon weniger." Das sitzt, weil der Stilkritiker sein Material liebt, in guten wie in schlechten Sätzen. Dass er neben präzisen Skizzen dann und wann in mystifizierende Metaphorik abgleitet ("In der Chemie des Stils kommt es auf jedes Element an"), mag nur konsequent sein. Keine Liebesrede ohne Pathos.
Ebenso verständlich, doch auffällig ist, dass das Material zunehmend jedes so nachdrucksvoll eingeforderte Maß sprengt. Formal hat Maars Wälzer sechs Kapitel, inhaltlich besteht er aus drei Teilen: einer kleinen Stillehre, einer langen (zu langen?) Folge zitatreich angelegter Porträts von Prosastilisten mit einem knappen Nachklapp zur Lyrik, schließlich einer thematischen Beispielreihung, in der sich verschiedene Stilisten an einem denkbar schwierigen Thema beweisen sollen: Sex.
Tatsächlich aber gerät das Buch ab etwa Seite 170 zum Florilegium. Mal traut Maar seinem Material zu, seine stilistische Kraft ganz allein zu entfalten, und begnügt sich mit Connaisseur-Einwürfen ("stark", "stilistisch reizvoll"), mal pointiert er es sehr genau, dann wieder flicht er Anekdötchen und Literaturquizze ein, verwandelt sich stilistisch seinem jeweiligen Gegenstand an und versteckt das eine oder andere abgefeimte Easter Egg in der eignen Prosa ("Es ist ein Gedicht mit der Komik-Energie eines durchdrehenden Dynamos"). Unterhaltsam ist das zweifellos, aber auch ein bisschen ausufernd, additiv in seiner Begeisterung.
Die dann allerdings - und das ist keine schlechte Pointe - eine vorläufige Antwort liefern soll auf die vollmundig gestellte, dann links liegen gelassene Titelfrage nach dem "Geheimnis großer Literatur". Die Beispiele gelungenen Stils sollen gegen schlechten empfindlich, am besten überempfindlich machen (meinethalben, Empfindlichkeiten kann man nie genug haben). Aber das Straucheln, das Ungelenke auch "großer Stilisten" zu beobachten könne dann doch etwa vom Geheimnis offenlegen: dass nämlich Literatur nicht mehr ist als Wirklichkeit, sondern immer ein bisschen weniger. Stil ist eine Frage des Scheiterns und Scheitern eine Frage des Stils.
JAN-FREDERIK BANDEL
Michael Maar: "Die Schlange im Wolfspelz". Rowohlt Verlag, Hamburg 2020. 656 S., geb., 34,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main