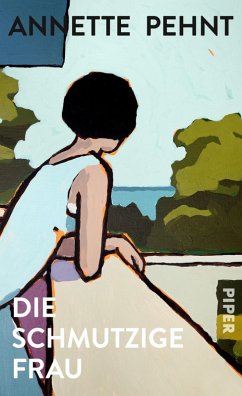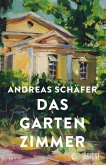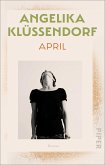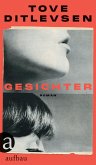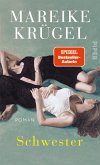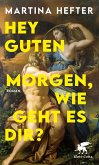Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Wie ging noch mal der Kopfstand? In Annette Pehnts Roman "Die schmutzige Frau" verschwimmt eine Schriftstellerin mit ihrer Erfindung
Den letzten Anstoß gibt das Wasser, das eines Morgens von der Decke tropft. Die Erzählerin von Annette Pehnts Roman "Die schmutzige Frau" registriert die Nässe auf den Möbeln und auf dem Teppich, legt ein paar Handtücher über die feuchten Stellen und wartet auf ihren Mann, damit der die Handwerker ruft. Nur lässt sich der Mann nicht blicken, an diesem Tag nicht und auch nicht am nächsten. Die Erzählerin bleibt in der Wohnung. Schließlich kommt ihr Mann doch noch vorbei, er erklärt, sich um alles kümmern zu wollen, und sie sagt, dass sie in dieser Wohnung nicht bleiben könne. Nachdem er wieder gegangen ist, packt auch sie ein, was sie braucht, eine warme Jacke, eine Klarsichthülle mit Manuskripten und einen Kugelschreiber, und geht endlich hinaus aus einer Wohnung, die Refugium sein sollte und Gefängnis war, womöglich auch etwas Drittes, das zwischen den beiden angesiedelt ist, je nach Perspektive.
Was das angeht, sind wir zunächst ganz auf die Erzählerin angewiesen, die zugleich eine Geschichte auftischt, die man kaum zum Nennwert nehmen kann: Ein Ehepaar hat zwei Kinder großgezogen und beschließt, sich bei aller Verbundenheit räumlich zu trennen: Die Frau, eben die Erzählerin, bezieht eine schicke Wohnung im oberen Stockwerk eines Neubaus im Stadtzentrum, die der Mann, der hier nur "Meinmann" heißt, für sie eingerichtet hat, damit sie dort in Ruhe schreiben kann. Sie soll, so beschließt der Mann, und sie stimmt zu, dort durch nichts abgelenkt werden und verzichtet daher auf Laptop, Internetzugang und Telefon. Es ist seine Sache, wann er sie dort besucht, er kündigt sich nicht an, was er mit den fehlenden Kommunikationsmöglichkeiten begründet. Was sie braucht, bestellt sie bei ihm, und er kauft es ein, da sie die Wohnung nicht verlässt.
So wirkt dieses Konstrukt, das zunächst wie eine spielerische Antwort auf Virginia Woolfs Essay "Ein Zimmer für sich allein" erscheint, ein Jahrhundert später wie eine bittere Farce: Aus dem Zimmer ist eine Wohnung geworden, das Ehepaar verfügt gemeinsam offenbar über weit mehr als fünfhundert Pfund im Jahr, aber gerade in der vermeintlichen Freiheit zum Schreiben, wie sie hier erreicht werden soll, ist die Frau abhängiger vom Ehemann als je zuvor. Ihr Argwohn geht dahin, dass er sich mit einer Künstlerin an seiner Seite schmückt, deren Talent man bewundern und die man sonst nicht groß ernst nehmen muss. Tatsächlich bringt er bei seinen unangekündigten Besuchen bald Fremde und frühere Freunde mit, Menschen, denen er seine Frau und deren rätselhaftes Tun geradezu vorführt, sodass die Wohnung in diesen Passagen ihren dritten Charakter zwischen Refugium und Gefängnis gewinnt: Sie wird zum Zoogehege und die Erzählerin zum exzentrischen Schaustück.
Warum, die Frage drängt sich nach wenigen Seiten auf, macht sie das mit? Warum spielt sie immer wieder mit dem Gedanken, die Wohnung einfach zu verlassen, und hält darin aus, Woche für Woche? Warum akzeptiert sie die verordnete Einsamkeit, verzichtet auf das gewünschte Haustier ebenso wie auf den Liebhaber, über den sie manchmal nachdenkt?
Die Antwort liefert sie zum Teil selbst, teils kann man sie erschließen. Zunächst ist da "Meinmann", dessen Funktion offenbar wichtiger ist als sein Name, um ihn zu bezeichnen. Er erscheint in ihren Erzählungen von seiner Gegenwart wie von der gemeinsamen Vergangenheit als äußerst selbstbewusst, redelustig und beruflich erfolgreich, zugleich empfindlich, wenn man sein Dozieren unterbricht, und in seiner Rolle als Vater eher unsicher, was sich in plötzlichem Dominanzgehabe gegenüber den heranwachsenden Kindern zeigt, die die Erzählerin dann mit schlechtem Gewissen unterstützt.
Je weiter der Roman vorankommt, desto mehr erfahren wir über einen Patriarchen, der sich fortschrittlich gibt, seine Entscheidungen allein fällt und als Konsens ausgibt, der in allem Regie führen muss und auf Störungen dabei höchst unwillig reagiert, der unter dem Zuspruch der Freundinnen der Erzählerin in eng umgrenztem Umfang Hausarbeiten verrichtet und zugleich jeden Widerspruch mit einem seiner gefürchteten kühlen Blicke quittiert - er sei "mit der Zeit gegangen", loben ihn Bekannte, und zugleich wirkt er in seinen Ansprüchen niederschmetternd gestrig.
So also beschreibt ihn die Erzählerin in den Teilen des Romans, in denen sie über ihre Situation spricht. Diese Passagen sind in freien Versen verfasst, was die Gattungsbezeichnung "Versroman" begründet, und dass die kurzen Abschnitte oder Zeilen, die hier je einen Vers bilden, ohne abschließendes Satzzeichen auskommen, unterstreicht noch einmal das Tastende dieser Notizen, besonders, wenn man sie laut liest. Außer "Meinmann" erscheinen die Personen hier (fast ausnahmslos) mit abgekürzten Vornamen, sie heißen G. oder V., während in den Geschichten, die von der Erzählerin in der Wohnung geschrieben und in ihre Notate montiert werden, die Figuren ausgeschriebene Namen tragen, die Schrift kursiv und die Erzählweise bis zur letzten Geschichte konventionell ist.
Die Übergänge zwischen diesen beiden Ebenen sind reizvoll; wir sehen, so scheint es zunächst, einer Schriftstellerin dabei zu, wie sie das, was ihr in der Arbeitswohnung widerfährt, in ihrem Schreiben aufscheinen lässt, mit welchem Grad an Absichtlichkeit auch immer. Eine wiederkehrende Protagonistin ist die titelgebende "Schmutzige Frau", die sich unangepasst und irrlichternd in einer Welt bewegt, die der ihrer Erfinderin eng verwandt ist und von Menschen bewohnt ist, denen sie für kurze Zeit zum Ersatz für die Geliebte, die Mutter oder die Tochter wird. Es ist eine Welt, in der sich der Unterdrücker als "Ermöglicher" sieht und sich wundert, dass die Frauen, die er damit beglücken will, dass er ihnen den Weg aufzeigt, das nicht verstehen und vor ihm Reißaus nehmen.
In den letzten Passagen schließlich kommen sich die Ebenen auch formal näher, die kursive Geschichte ist in Versen gehalten, und einer ihrer Protagonisten trifft nun mit der entflohenen Erzählerin zusammen, die in seinem Gästebett übernachtet wie zuvor ihre Protagonistin, die schmutzige Frau.
"Manchmal übe ich den Kopfstand, den ich früher so gut beherrscht habe", notiert die Erzählerin kurz nach dem Einzug in die Schreibwohnung, "aber ich kann den Punkt nicht mehr finden." Es ist eine von vielen beiläufig eingestreuten Bemerkungen, die auf Elementares zielen und so den Roman durchaus kalkuliert erscheinen lassen. Die Erzählerin, die früher offenbar einiges publiziert hatte, vermisst nun die radikal andere Perspektive auf eine Welt, die auf dem Kopf steht.
Die Erfindung der schmutzigen Frau durch die Erzählerin, in vielem ihr Gegensatz, ermöglicht diese Perspektive, so wie das allmähliche und diskret vorbereitete Zusammenfallen der Ebenen am Ende eine Erlösung suggeriert. Dass sich etwas bewegt in der Trennung, deutete sich an, als zwei Gäste in der Wohnung statt mit den üblichen Initialen kurz mit vollen Namen angeredet wurden, was wie ein Wetterleuchten wirkte. Die Erzählerin jedenfalls überlegt am Ende, auf dem Weg zu "G.": "Ich habe eine Geschichte über ihn geschrieben, vielleicht könnte ich sie ihm zeigen." Darauf wird "Meinmann" wohl länger warten. TILMAN SPRECKELSEN
Annette Pehnt: "Die schmutzige Frau". Versroman.
Piper Verlag, München 2023. 176 S., geb., 22,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH