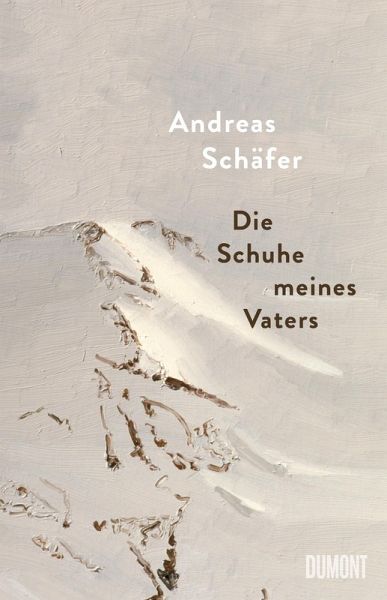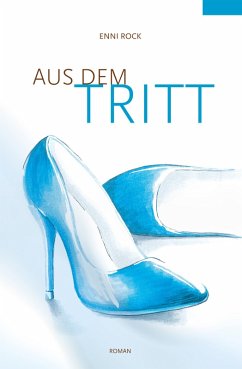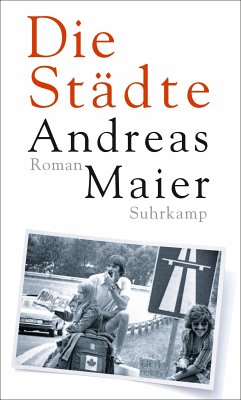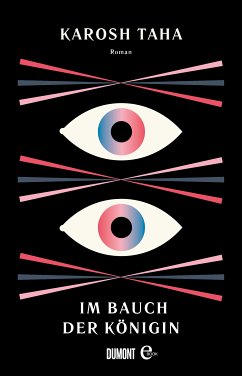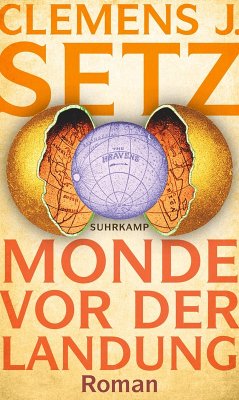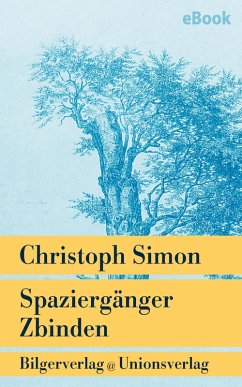Andreas Schäfer
eBook, ePUB
Die Schuhe meines Vaters (eBook, ePUB)
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 13,00 €**
**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!






Im Sommer 2018 kommt der Vater von Andreas Schäfer zu Besuch nach Berlin. Kurz zuvor hat er erfahren, dass er an Krebs erkrankt ist, doch Beschwerden hat er keine. Er geht in die Oper, unternimmt einen Ausflug ans Meer, sitzt auf dem Sofa des Sohnes und sagt verwundert: »Dass da was ist!« Aber was? Was ist da im Kopf des Vaters? Er fährt nach Frankfurt zurück, wo er seit der Trennung von der griechischen Mutter allein lebt. Auch zur Biopsie geht er allein. Am Tag der Untersuchung meldet sich ein Arzt und teilt dem Sohn mit, dass der Vater eine Hirnblutung erlitten habe: »Ihr Vater wird s...
Im Sommer 2018 kommt der Vater von Andreas Schäfer zu Besuch nach Berlin. Kurz zuvor hat er erfahren, dass er an Krebs erkrankt ist, doch Beschwerden hat er keine. Er geht in die Oper, unternimmt einen Ausflug ans Meer, sitzt auf dem Sofa des Sohnes und sagt verwundert: »Dass da was ist!« Aber was? Was ist da im Kopf des Vaters? Er fährt nach Frankfurt zurück, wo er seit der Trennung von der griechischen Mutter allein lebt. Auch zur Biopsie geht er allein. Am Tag der Untersuchung meldet sich ein Arzt und teilt dem Sohn mit, dass der Vater eine Hirnblutung erlitten habe: »Ihr Vater wird sterben«, sagt er. »Er liegt im künstlichen Koma. Sie müssen entscheiden, wann wir die Maschinen abstellen.« Wie damit umgehen, wenn einem das Leben des eigenen Vaters in die Hände gelegt wird? ¿Die Schuhe meines Vaters¿ ist ein ebenso erschütterndes wie zu Herzen gehendes Buch über Väter und Söhne und die unerwarteten Wege der Trauer. Aufrichtig, poetisch und einfühlsam erzählt Andreas Schäfer vom eigenen Schockzustand ¿ vor allem aber nähert er sich dem Vater an, dem leidenschaftlich gern Reisenden, dem Kriegstraumatisierten, und ihrem besonderen, nicht immer einfachen Verhältnis.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, SLO, SK ausgeliefert werden.
- Geräte: eReader
- ohne Kopierschutz
- eBook Hilfe
- Größe: 1.29MB
- FamilySharing(5)
- Text-to-Speech
ANDREAS SCHÄFER wurde 1969 in Hamburg geboren, wuchs bei Frankfurt/Main auf und lebt heute mit seiner Familie in Berlin. Er schreibt Romane, Essays, Libretti und Radiofeatures. Sein Debüt >Auf dem Weg nach Messara< wurde u. a. mit dem Bremer Literaturförderpreis ausgezeichnet. Es folgten die Romane >Wir vier< (DuMont 2010), der für den Deutschen Buchpreis nominiert war und mit dem Anna-Seghers-Preis ausgezeichnet wurde, >Gesichter< (DuMont 2013) und zuletzt der Spiegel-Bestseller >Das Gartenzimm
Produktdetails
- Verlag: DuMont Buchverlag GmbH
- Seitenzahl: 208
- Erscheinungstermin: 19. Juli 2022
- Deutsch
- ISBN-13: 9783832182588
- Artikelnr.: 63897927
Perlentaucher-Notiz zur Dlf-Rezension
Rezensentin Wiebke Porombka ist beeindruckt. Dem Autor Andreas Schäfer gelingt in seinem autobiografischen Bericht eine vorsichtige Annäherung an die ambivalente Vaterfigur, die diese weder idealisiert noch lächerlich macht. Die Rezensentin ist berührt vom Porträt eines Mannes, der seine Kindheit im Nationalsozialismus verbrachte und zeitlebens innerlich zerrissen und einsam blieb. Zugleich hält sie das Buch auch für eine unprätentiöse zeitgeschichtliche Betrachtung des kulturellen Wandels der Bundesrepublik.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Die herausragendsten [Personal Essays] verwandeln eine persönliche Erfahrung in literarische Meisterstücke, in denen grundsätzliche Bedingungen des Menschseins aufscheinen - so wie es Joan Didion in ihrem Trauerbuch 'Das Jahr des magischen Denkens' gelungen ist oder Julian Barnes in seinen 'Lebensstufen'. Um es gleich vorweg zu sagen: Andreas Schäfers 'Die Schuhe meines Vaters' muss sich vor diesen Büchern nicht verstecken.« Ulrich Rüdenauer, SÜDDEUTSCHE ZEITUNG »Ein Werk, das durch die Konkretheit seiner Bilder, Szenen und psychologischen Porträts die Leserschaft packt.« Thomas Linden, KÖLNISCHE RUNDSCHAU »Auf jeden Fall ein tröstliches und schönes Buch« Andrea Gerk, DEUTSCHLANDFUNK KULTUR »Darf man das: die Trauer eines Menschen
Mehr anzeigen
rezensieren, ihn bewerten für die Art, auf die er eine existenzielle Situation zu bewältigen versucht? Falls es erlaubt sein sollte, verneigt der Rezensent sich an dieser Stelle vor dem Autor.« Tobias Becker, SPIEGEL.DE »Ein unwahrscheinlich präzises Buch [...] mit vielen poetischen Momenten« Gerrit Bartels, RBB KULTUR »Er berührt, weil uns sein Autor samt seiner Zweifel unverstellt in sein Inneres blicken lässt. Wer diesen Roman liest, kann sich daher in einer Hinsicht glücklich schätzen: In der Einsamkeit sind wir nie allein.« Björn Hayer, ZEIT ONLINE »Beeindruckend ist nicht allein, wie Andreas Schäfer das eigene ambivalente Verhältnis zum Vater zu reflektieren versteht. Berührend ist vor allem die Zerrissenheit des Vaters, die man für die Zerrissenheit einer ganzen Generation nehmen mag.« Wiebke Porombka, DEUTSCHLANDFUNK KULTUR »Es ist eine schonungslose Selbstbesinnung, die Andreas Schäfer zu den eigenen Abgründen führt.« Ulrich Rüdenauer, TAGES-ANZEIGER »Ein[...] besondere[s] Erinnerungsbuch« Martin Oehlen, FRANKFURTER RUNDSCHAU »Der kluge Aufbau des Buches, die intime, aber niemals voyeuristische Betrachtung der Familie, die fein formulierten Sätze - all das macht 'Die Schuhe meines Vaters' zu einem beeindruckenden Buch.« Torben Rosenbohm, NORDWEST ZEITUNG »Ein Roadmovie der letzten Lebensstrecke, melancholisch, aber durchaus auch komisch.« Ursula Ott, CHRISMON »Ein ebenso persönliches wie allgemeingültiges Buch über die verschlungenen Pfade der Trauer. Und über die Geschichte, die oft die rätselhafteste ist im Leben: die Geschichte der eigenen Eltern. [...]. Ihm gelingt es dabei, die spröde Poesie einzufangen, die den Beziehungen zwischen Vätern und Söhnen oft zu eigen ist.« Tobias Becker, DER SPIEGEL »Ein sehr lesenswertes, bewegendes Buch.« Oliver Pfohlmann, DER TAGESSPIEGEL »'Die Schuhe meines Vaters' ist ein stilles, schlicht schönes Buch.« Katharina Kluin, STERN »Es ist wirklich sehr schön, wie Andreas Schäfer am Schluss seines Buchs die ganze Profanität, aber auch Spiritualität so eines Unternehmens einfängt.« Dirk Knipphals, TAZ »Der Schriftsteller Andreas Schäfer erzählt eine Vater-Sohn-Geschichte, die sehr persönlich ist, weil sie das Verhältnis zum eigenen Vater genau untersucht, und zwar im Moment des Abschied Nehmens.« Marija Bakker, WDR5 »Literarisch überzeugend in Aufbau, Rhythmus und Gedankenführung, emotional berührend auch. Und so, wie das Erzählen trösten kann, vermag das Lesen das oft auch.« Cornelia Geißler, BERLINER ZEITUNG »Es ist eine unspektakuläre Geschichte, die uns der deutsch-griechische Schriftsteller [...] erzählt. Sie hallt jedoch lange im Leser, in der Leserin nach.« Michael Angele, DER FREITAG »Ein dicht gewebtes Erinnerungsbuch und eine immer wieder bewegende Lektüre« Ronald Schneider, RHEINISCHE POST »Andreas Schäfer findet eindringliche Worte für die schwere Situation, ohne dass sein Text dabei unter Kitschverdacht fallen würde. [...] 'Die Schuhe meines Vaters' sind eine eindringliche Liebeserklärung und eine intime Selbstbefragung und Suche nach der Herkunft.« Welf Grombacher, MÄRKISCHE ODERZEITUNG »Die berührende Geschichte von Vater und Sohn und die unerwarteten Wege der Trauer - aufrichtig, poetisch, einfühlsam.« DINGOLFINGER ANZEIGER »'Die Schuhe meines Vaters' ist ein stilles Buch, ein behutsamer Annäherungsversuch, eine Liebeserklärung, die frei von Kitsch bleibt.« Dana Toschner, MAGDEBURGER VOLKSSTIMMEN »Schäfer erzählt vom allmählichen Sterben, vom selbstbewussten Leben, vom schrecklichen Abschied - so traurig wie tröstlich.« FOCUS »In dem berührenden, sensiblen und sehr persönlichen Buch findet der Sohn erst nach dessen Tod und verursacht durch seine Trauer zu einem vollständigen Bild und einem neuen, versöhnlichen Verständnis für seinen Vater.« Ingrid Mosblech-Kaltwasser, DER KULTUR BLOG
Schließen
Das Besondere am autobiografischen Vaterbuch von Andreas Schäfer ist für den Rezensenten Martin Oehlen der Umstand, dass die Suche des Autors auf den Spuren des Verstorbenen zu nichts führt bzw. nur zu noch mehr Distanz. Dramatisch findet Oehlen den Einstieg, der den Leser mit dem Abschalten der lebenserhaltenden Geräte in die Geschichte hineinzieht. Wenn Schäfer das impulsive, oft kränkende Verhalten des Vaters mit den Schrecken des 20. Jahrhunderts in Verbindung bringt, die Geschichte einer deutsch-griechischen Ehe im konservativen Nachkriegsdeutschland erzählt und schließlich vor der selbst gestellten Aufgabe kapituliert, folgt Oehlen dem Autor bedingungslos.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Ich bin
wie er
Zu allen Zeiten arbeiten sich Söhne
schmerzvoll an ihren Vätern ab.
Andreas Schäfer schreibt die gigantische
literarische Tradition dieser Beziehung
in die Gegenwart fort
VON ULRICH RÜDENAUER
Als die Männer der Jahrgänge um 1970 vor einigen Jahren Kinder bekamen und sich in die Erzieherrolle einfinden mussten, fiel auffallend häufig der Satz: „Ich möchte alles anders machen als mein Vater.“ Wem sie da auf keinen Fall nacheifern wollten, konnte sich je nach Familienkonstellation unterscheiden – dem dauerhaft abwesenden, dem notorisch abweisenden, dem ständig abreisenden Vater. Offenbar stimmte auch mit dieser Nachkriegsgeneration irgendetwas nicht, die viel mit sich
wie er
Zu allen Zeiten arbeiten sich Söhne
schmerzvoll an ihren Vätern ab.
Andreas Schäfer schreibt die gigantische
literarische Tradition dieser Beziehung
in die Gegenwart fort
VON ULRICH RÜDENAUER
Als die Männer der Jahrgänge um 1970 vor einigen Jahren Kinder bekamen und sich in die Erzieherrolle einfinden mussten, fiel auffallend häufig der Satz: „Ich möchte alles anders machen als mein Vater.“ Wem sie da auf keinen Fall nacheifern wollten, konnte sich je nach Familienkonstellation unterscheiden – dem dauerhaft abwesenden, dem notorisch abweisenden, dem ständig abreisenden Vater. Offenbar stimmte auch mit dieser Nachkriegsgeneration irgendetwas nicht, die viel mit sich
Mehr anzeigen
selbst, dem wirtschaftlichen Aufstieg und wiederum den eigenen Vätern zu tun gehabt hatte. Im Prinzip aber setzte sich in da ein uraltes Prinzip fort: Vatermord ist noch immer der zuverlässigste Motor gesellschaftlichen Wandels.
Die von Männern verfasste Literatur hat sich immer für diese psychologisch komplexe Lage interessiert. „Väter und Söhne“, der deutsche Titel von Turgenjews 1861 entstandenem Roman, könnte über einer ganzen Bibliothek von Vater-Sohn-Geschichten prangen. Der Fokus hat sich dabei stets ein wenig verschoben, je nach gesellschaftlichen Bedrängnissen, therapeutischem Erkenntnisstand und politischen Stimmungslagen. Aber gemeinsam ist ihnen doch, dass es um patriarchale Machtkämpfe geht, um Abrechnungen mit dem Pater familias, um Ablösungsprozesse und Erlösungssehnsüchte.
Richtige Höhenkammtexte hat das hervorgebracht, man denke nur an Kafkas „Brief an den Vater“ oder „Das Urteil“. Und in den 1970er-Jahren hierzulande auch einige einflussreiche Erkundungen, die das Unbehagen an den Nazi-Vätern und den Zwiespalt der Söhne auf subjektive Weise neu formulierten, Bernward Vespers „Die Reise“ etwa oder Christoph Meckels „Suchbild. Über meinen Vater“. Interessanterweise beides Vergeltungsbücher: Schreibende Über-Väter mussten von der Bühne geschubst werden, auf der man selbst reüssieren wollte. Väter sind in diesen Texten entweder furchtbar grell leuchtende Heroen oder tyrannische Instanzen, unerreichbare Vorbilder oder zu bekämpfende Gegner.
Eine Auseinandersetzung mit kühlem Kopf setzt meist spät ein, dann, wenn die Kräfte der Altvorderen schwinden, sie dahinsiechen, von ihrem Sockel plumpsen oder bereits abgetreten sind. Ein Autor bekannte einmal im Gespräch, er habe erst wirklich mit dem Schreiben beginnen können, als sein Vater gestorben war. Endlich Luft zum Atmen!
Die in den vergangenen Jahren erschienenen Vater-Bücher unterscheiden sich von jenen aus den Siebziger- und Achtzigerjahren schon alleine dadurch, dass nun zunehmend die im oder nach dem Krieg geborenen Väter in den Blick geraten. Die Beschädigungen der Kriegskinder sind andere als die der Täter und Mitläufer. Einfacher macht das die Sache nicht. Am Ende bleibt es bei den ewig gleichen Fragen – nach verkorksten Lebensläufen, schwierig auszutarierenden Beziehungsstrukturen, lästigen Konkurrenzgefühlen, Abgrenzungsverlangen und der eigenen Identität. Wie wurde ich bloß zu dem, der ich bin?
„Natürlich war ich wie er“, bekennt Andreas Schäfer. „Nicht nur erkannte ich immer öfter seine Züge im eigenen Spiegelbild (und wurde besonders bei schnellen, unbedachten Blicken von der Ähnlichkeit überrascht). Vollführte ich im Schreck nicht auch ähnlich ruckartige Bewegungen, floh vor den eigenen vier Wänden ins Café oder geriet viel zu schnell – ein Funken genügte – in Rage?“ Der 1969 geborene Schäfer, der vier Romane veröffentlicht hat und als Theaterkritiker bekannt wurde, liefert mit „Die Schuhe meines Vaters“ das jüngste Beispiel für das Sohn-Vater-Genre, und er wählt dafür eine Form, die in angelsächsischen Ländern schon länger hohes Ansehen genießt, aber auch in der deutschsprachigen Literatur inzwischen angekommen ist – den Personal Essay.
Die herausragendsten dieser Versuche verwandeln eine persönliche Erfahrung in literarische Meisterstücke, in denen grundsätzliche Bedingungen des Menschseins aufscheinen – so wie es Joan Didion in ihrem Trauerbuch „Das Jahr des magischen Denkens“ gelungen ist oder Julian Barnes in seinen „Lebensstufen“. Um es gleich vorweg zu sagen: Andreas Schäfers „Die Schuhe meines Vaters“ muss sich vor diesen Büchern nicht verstecken. Ihm glückt die Balance zwischen zweifelnd-zärtlicher Hommage und befreiender Inventarisierung. Ein Schicksal wendet sich hier, auch dank der hochreflektierten, das eigene Tun hinterfragenden Machart des Buches, ins Allgemeine. Der Vater ist ein Einzelner und zugleich Vertreter einer von Kriegstraumata beschwerten Generation: Requiem auf einen Mann, der immer vom Verlust seines inneren Gleichgewichts bedroht war.
„Die Schuhe meines Vaters“ setzt ein mit einem Abschied: Zum letzten Mal kommt Robert Schäfer zu Besuch nach Berlin. Eine Krebsdiagnose und ein operativer Eingriff schweben unheilvoll über dieser Reise. Noch einmal gibt es Gespräche mit dem Sohn Andreas, ein vermeintlich unbeschwertes Zusammensein mit der Enkeltochter. Ein paar Tage später der Anruf aus dem Krankenhaus: Nach einer Hirnblutung liegt der Vater im Koma.
Andreas Schäfer reist nach Frankfurt. Die seit Langem wieder in ihrer Heimat lebende griechische Mutter – vor Jahrzehnten hatten sich die Eltern getrennt – eilt ebenfalls ans Krankenbett. Hoffnung besteht keine mehr. Das Einzige, was zu tun bleibt, ist, den Zeitpunkt des Todes zu bestimmen – wann sollen die Maschinen abgestellt werden? Kann das Kind zum Richter über den Vater werden?
Wie in Philip Roths innigem Porträt „Mein Leben als Sohn“ setzt dieser existenzielle Moment einen Erinnerungsprozess in Gang, den Wunsch, dem lange Zeit unverstandenen und auch gefürchteten Vater eine Geschichte zu geben. Unversehens entsteht aus staunendem Unglauben und aus der Trauer ein Erzähldrang, beginnt die „Verwandlung eines realen Menschen in eine Buchfigur“. Zwei Jahre nach Robert Schäfers Tod fängt der Sohn damit an, den Vaterroman zu schreiben.
Aus Fotoalben, Notizen, Reisetagebüchern, Landkarten, Flugtickets, unscheinbaren und verborgenen Zeugnissen, setzt sich für Andreas Schäfer erst nach und nach ein komplettes Leben zusammen, wo vorher eine rätselhaft zerrissene Gestalt regierte. „Es war mir offenbar unmöglich, mich von den Dingen des Vaters zu trennen, ohne dass sich an den Rändern des Bewusstseins das vage Gebilde einer Vater-Erfindung abzeichnete.“
Es gibt nämlich mindestens zwei Robert Schäfers, und es ist eine Herausforderung, diese beiden miteinander in Einklang zu bringen: Da ist der launenhafte, zu Besserwisserei und cholerischen Anfällen neigende Vater, ehemals Revisor bei der Coop-Genossenschaft; ein Einzelkämpfer, der nach der Trennung von seiner Frau jahrzehntelang alleine lebt. Und jener Mann, der mutig mit den eigenen Eltern bricht, weil diese etwas gegen die „dahergelaufene“ Griechin einzuwenden haben; der im Alter zu abenteuerlichen Reisen aufbricht, zu schreiben beginnt und zum reizenden Großvater wird. Er ist der peinlich selbstgefällige Schwadroneur und der neugierige und begeisterungsfähige Rentner, der Bekanntschaften in der ganzen Welt schließt.
Wer Abschied nimmt, neigt zur Nachsicht. Die Melancholie trübt den Blick, aber sie kann ihn zuweilen auch schärfen. Andreas Schäfer lässt seinem Vater Gerechtigkeit widerfahren, weil er dessen Widersprüche nicht kassiert. Die erst führen zum Kern, zum Unerschlossenen und Verschwiegenen. Der Autor stöbert in der Kindheit des Vaters wie ein Analytiker in der Seele seines Patienten, und er stößt auf das die lebenslange Unruhe erklärende Trauma: In den letzten Kriegstagen wurde das Heim der Familie ausgebombt. „Sein nervöses, flatterndes Herz, das schnelle Außer-sich-Geraten – bis heute besteht in meinem Vater-Bild ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem in Flammen stehenden Haus und seiner eigenen, jeden Moment möglichen Entflammbarkeit.“
Der „seelische Schmiss“, den Schäfer an sich selbst diagnostiziert, entstellt schon den Vater. Andreas Schäfer will die „aus Schutz vor Verletzung aufgebaute Halbdistanz“ überwinden, versucht, im Vater den kleinen Jungen zu sehen, der in Berlin auf- und in den Krieg hineingewachsen ist. Er fährt mit diesem Kind an den Bodensee zu Tante Mariechen, die ihm ein Gefühl von Heimat gegeben hat, als in der Hauptstadt die Bomben fielen. Und Andreas Schäfer fragt sich, was dieser Halbwüchsige von seiner Zeit mitbekommen haben mag, ob er die riesigen Menschenmengen übersehen konnte, die in unmittelbarer Nachbarschaft der Familie zu den Bahnhöfen und schließlich in den Tod getrieben wurden.
Er schlüpft in die Haut des Vaters. Und nicht zuletzt das führt zur ernüchternden Erkenntnis, bei allen Fluchtbewegungen „natürlich wie er zu sein“. Es ist eine schonungslose Selbstbesinnung, die Andreas Schäfer zu den eigenen Abgründen führt: „,Ich habe noch nie keine Angst vor dir gehabt‘, hatte meine Tochter mal gesagt, als wir uns nach einem Streit wieder vertragen hatten und ich sie fragte, ob sie sich manchmal vor mir fürchte.“ Einen ehrlicheren, erschreckenderen Satz kann man sich kaum denken. Ohne die vorausgegangene Vatersuche wäre er wohl kaum möglich.
Anruf aus dem Krankenhaus:
Nach einer Hirnblutung
liegt der Vater im Koma
Der selbstgefällige Schwadroneur
und der begeisterungsfähige
Rentner in einer Person
Andreas Schäfer: Die Schuhe meines Vaters. Dumont, Köln 2022.
192 Seiten, 22 Euro.
Will im Schreiben über den Vater die „aus Schutz vor Verletzung aufgebaute Halbdistanz“ überwinden: Der Journalist und Autor Andreas Schäfer.
Foto: Mirella Weingarten/Dumont
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Die von Männern verfasste Literatur hat sich immer für diese psychologisch komplexe Lage interessiert. „Väter und Söhne“, der deutsche Titel von Turgenjews 1861 entstandenem Roman, könnte über einer ganzen Bibliothek von Vater-Sohn-Geschichten prangen. Der Fokus hat sich dabei stets ein wenig verschoben, je nach gesellschaftlichen Bedrängnissen, therapeutischem Erkenntnisstand und politischen Stimmungslagen. Aber gemeinsam ist ihnen doch, dass es um patriarchale Machtkämpfe geht, um Abrechnungen mit dem Pater familias, um Ablösungsprozesse und Erlösungssehnsüchte.
Richtige Höhenkammtexte hat das hervorgebracht, man denke nur an Kafkas „Brief an den Vater“ oder „Das Urteil“. Und in den 1970er-Jahren hierzulande auch einige einflussreiche Erkundungen, die das Unbehagen an den Nazi-Vätern und den Zwiespalt der Söhne auf subjektive Weise neu formulierten, Bernward Vespers „Die Reise“ etwa oder Christoph Meckels „Suchbild. Über meinen Vater“. Interessanterweise beides Vergeltungsbücher: Schreibende Über-Väter mussten von der Bühne geschubst werden, auf der man selbst reüssieren wollte. Väter sind in diesen Texten entweder furchtbar grell leuchtende Heroen oder tyrannische Instanzen, unerreichbare Vorbilder oder zu bekämpfende Gegner.
Eine Auseinandersetzung mit kühlem Kopf setzt meist spät ein, dann, wenn die Kräfte der Altvorderen schwinden, sie dahinsiechen, von ihrem Sockel plumpsen oder bereits abgetreten sind. Ein Autor bekannte einmal im Gespräch, er habe erst wirklich mit dem Schreiben beginnen können, als sein Vater gestorben war. Endlich Luft zum Atmen!
Die in den vergangenen Jahren erschienenen Vater-Bücher unterscheiden sich von jenen aus den Siebziger- und Achtzigerjahren schon alleine dadurch, dass nun zunehmend die im oder nach dem Krieg geborenen Väter in den Blick geraten. Die Beschädigungen der Kriegskinder sind andere als die der Täter und Mitläufer. Einfacher macht das die Sache nicht. Am Ende bleibt es bei den ewig gleichen Fragen – nach verkorksten Lebensläufen, schwierig auszutarierenden Beziehungsstrukturen, lästigen Konkurrenzgefühlen, Abgrenzungsverlangen und der eigenen Identität. Wie wurde ich bloß zu dem, der ich bin?
„Natürlich war ich wie er“, bekennt Andreas Schäfer. „Nicht nur erkannte ich immer öfter seine Züge im eigenen Spiegelbild (und wurde besonders bei schnellen, unbedachten Blicken von der Ähnlichkeit überrascht). Vollführte ich im Schreck nicht auch ähnlich ruckartige Bewegungen, floh vor den eigenen vier Wänden ins Café oder geriet viel zu schnell – ein Funken genügte – in Rage?“ Der 1969 geborene Schäfer, der vier Romane veröffentlicht hat und als Theaterkritiker bekannt wurde, liefert mit „Die Schuhe meines Vaters“ das jüngste Beispiel für das Sohn-Vater-Genre, und er wählt dafür eine Form, die in angelsächsischen Ländern schon länger hohes Ansehen genießt, aber auch in der deutschsprachigen Literatur inzwischen angekommen ist – den Personal Essay.
Die herausragendsten dieser Versuche verwandeln eine persönliche Erfahrung in literarische Meisterstücke, in denen grundsätzliche Bedingungen des Menschseins aufscheinen – so wie es Joan Didion in ihrem Trauerbuch „Das Jahr des magischen Denkens“ gelungen ist oder Julian Barnes in seinen „Lebensstufen“. Um es gleich vorweg zu sagen: Andreas Schäfers „Die Schuhe meines Vaters“ muss sich vor diesen Büchern nicht verstecken. Ihm glückt die Balance zwischen zweifelnd-zärtlicher Hommage und befreiender Inventarisierung. Ein Schicksal wendet sich hier, auch dank der hochreflektierten, das eigene Tun hinterfragenden Machart des Buches, ins Allgemeine. Der Vater ist ein Einzelner und zugleich Vertreter einer von Kriegstraumata beschwerten Generation: Requiem auf einen Mann, der immer vom Verlust seines inneren Gleichgewichts bedroht war.
„Die Schuhe meines Vaters“ setzt ein mit einem Abschied: Zum letzten Mal kommt Robert Schäfer zu Besuch nach Berlin. Eine Krebsdiagnose und ein operativer Eingriff schweben unheilvoll über dieser Reise. Noch einmal gibt es Gespräche mit dem Sohn Andreas, ein vermeintlich unbeschwertes Zusammensein mit der Enkeltochter. Ein paar Tage später der Anruf aus dem Krankenhaus: Nach einer Hirnblutung liegt der Vater im Koma.
Andreas Schäfer reist nach Frankfurt. Die seit Langem wieder in ihrer Heimat lebende griechische Mutter – vor Jahrzehnten hatten sich die Eltern getrennt – eilt ebenfalls ans Krankenbett. Hoffnung besteht keine mehr. Das Einzige, was zu tun bleibt, ist, den Zeitpunkt des Todes zu bestimmen – wann sollen die Maschinen abgestellt werden? Kann das Kind zum Richter über den Vater werden?
Wie in Philip Roths innigem Porträt „Mein Leben als Sohn“ setzt dieser existenzielle Moment einen Erinnerungsprozess in Gang, den Wunsch, dem lange Zeit unverstandenen und auch gefürchteten Vater eine Geschichte zu geben. Unversehens entsteht aus staunendem Unglauben und aus der Trauer ein Erzähldrang, beginnt die „Verwandlung eines realen Menschen in eine Buchfigur“. Zwei Jahre nach Robert Schäfers Tod fängt der Sohn damit an, den Vaterroman zu schreiben.
Aus Fotoalben, Notizen, Reisetagebüchern, Landkarten, Flugtickets, unscheinbaren und verborgenen Zeugnissen, setzt sich für Andreas Schäfer erst nach und nach ein komplettes Leben zusammen, wo vorher eine rätselhaft zerrissene Gestalt regierte. „Es war mir offenbar unmöglich, mich von den Dingen des Vaters zu trennen, ohne dass sich an den Rändern des Bewusstseins das vage Gebilde einer Vater-Erfindung abzeichnete.“
Es gibt nämlich mindestens zwei Robert Schäfers, und es ist eine Herausforderung, diese beiden miteinander in Einklang zu bringen: Da ist der launenhafte, zu Besserwisserei und cholerischen Anfällen neigende Vater, ehemals Revisor bei der Coop-Genossenschaft; ein Einzelkämpfer, der nach der Trennung von seiner Frau jahrzehntelang alleine lebt. Und jener Mann, der mutig mit den eigenen Eltern bricht, weil diese etwas gegen die „dahergelaufene“ Griechin einzuwenden haben; der im Alter zu abenteuerlichen Reisen aufbricht, zu schreiben beginnt und zum reizenden Großvater wird. Er ist der peinlich selbstgefällige Schwadroneur und der neugierige und begeisterungsfähige Rentner, der Bekanntschaften in der ganzen Welt schließt.
Wer Abschied nimmt, neigt zur Nachsicht. Die Melancholie trübt den Blick, aber sie kann ihn zuweilen auch schärfen. Andreas Schäfer lässt seinem Vater Gerechtigkeit widerfahren, weil er dessen Widersprüche nicht kassiert. Die erst führen zum Kern, zum Unerschlossenen und Verschwiegenen. Der Autor stöbert in der Kindheit des Vaters wie ein Analytiker in der Seele seines Patienten, und er stößt auf das die lebenslange Unruhe erklärende Trauma: In den letzten Kriegstagen wurde das Heim der Familie ausgebombt. „Sein nervöses, flatterndes Herz, das schnelle Außer-sich-Geraten – bis heute besteht in meinem Vater-Bild ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem in Flammen stehenden Haus und seiner eigenen, jeden Moment möglichen Entflammbarkeit.“
Der „seelische Schmiss“, den Schäfer an sich selbst diagnostiziert, entstellt schon den Vater. Andreas Schäfer will die „aus Schutz vor Verletzung aufgebaute Halbdistanz“ überwinden, versucht, im Vater den kleinen Jungen zu sehen, der in Berlin auf- und in den Krieg hineingewachsen ist. Er fährt mit diesem Kind an den Bodensee zu Tante Mariechen, die ihm ein Gefühl von Heimat gegeben hat, als in der Hauptstadt die Bomben fielen. Und Andreas Schäfer fragt sich, was dieser Halbwüchsige von seiner Zeit mitbekommen haben mag, ob er die riesigen Menschenmengen übersehen konnte, die in unmittelbarer Nachbarschaft der Familie zu den Bahnhöfen und schließlich in den Tod getrieben wurden.
Er schlüpft in die Haut des Vaters. Und nicht zuletzt das führt zur ernüchternden Erkenntnis, bei allen Fluchtbewegungen „natürlich wie er zu sein“. Es ist eine schonungslose Selbstbesinnung, die Andreas Schäfer zu den eigenen Abgründen führt: „,Ich habe noch nie keine Angst vor dir gehabt‘, hatte meine Tochter mal gesagt, als wir uns nach einem Streit wieder vertragen hatten und ich sie fragte, ob sie sich manchmal vor mir fürchte.“ Einen ehrlicheren, erschreckenderen Satz kann man sich kaum denken. Ohne die vorausgegangene Vatersuche wäre er wohl kaum möglich.
Anruf aus dem Krankenhaus:
Nach einer Hirnblutung
liegt der Vater im Koma
Der selbstgefällige Schwadroneur
und der begeisterungsfähige
Rentner in einer Person
Andreas Schäfer: Die Schuhe meines Vaters. Dumont, Köln 2022.
192 Seiten, 22 Euro.
Will im Schreiben über den Vater die „aus Schutz vor Verletzung aufgebaute Halbdistanz“ überwinden: Der Journalist und Autor Andreas Schäfer.
Foto: Mirella Weingarten/Dumont
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Schließen
Gebundenes Buch
Andreas Schäfer setzt seinem Vater, zu dem das Verhältnis nicht immer einfach war, mit diesem Buch ein literarisches Denkmal.
Es beginnt mit der Nachricht vom lebensbedrohlichen Zustand und seiner Entscheidung ob und wann lebenserhaltende Maßnahmen beendet werden. Schäfer …
Mehr
Andreas Schäfer setzt seinem Vater, zu dem das Verhältnis nicht immer einfach war, mit diesem Buch ein literarisches Denkmal.
Es beginnt mit der Nachricht vom lebensbedrohlichen Zustand und seiner Entscheidung ob und wann lebenserhaltende Maßnahmen beendet werden. Schäfer erzählt von den Einflüssen seines Vaters auf sein Leben, dem Leben seines Vaters mit Höhen und Tiefen und welches Andenken in seiner eigenen Familie weiter leben wird.
Das Buch ist sehr einfühlsam geschrieben, regt zum Nachdenken über die eigene Familie an und nimmt den Leser mit in die Geschichte des Autors.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Abschied eines Sohnes
"Die Schuhe meines Vaters" von Andreas Schäfer ist ein Abschied des Autors von seinem Vater. Es ist ein Abschied, der sehr viel von einem Kennenlernen hat und das macht dieses Buch zu etwas Besonderem.
Der Vater wohnt in Frankfurt und kommt im Sommer 2018 zu …
Mehr
Abschied eines Sohnes
"Die Schuhe meines Vaters" von Andreas Schäfer ist ein Abschied des Autors von seinem Vater. Es ist ein Abschied, der sehr viel von einem Kennenlernen hat und das macht dieses Buch zu etwas Besonderem.
Der Vater wohnt in Frankfurt und kommt im Sommer 2018 zu seinem Sohn zu Besuch nach Berlin. Er erzählt von einer geplanten Biopsie, die nach einer überstandenen Krebserkrankung nötig wird. Er stuft sie nicht als bedrohlich ein und möchte auch keine Begleitung dabei. Für alle ist es ein Schock, als dann der Arzt anruft und den Sohn vor die Entscheidung stellt, wann das künstliche Koma zu beenden ist, also wann die Maschinen abgestellt werden und der Vater sterben wird.
Der Sohn fährt natürlich sofort hin und begibt sich auf Spurensuche, auf eine Reise in die Vergangenheit, eine Reise in seine eigene Kindheit, und noch weiter zurück. Er macht sich auf, um seinen Vater kennenzulernen, ehe er ihn loslassen, ihn gehenlassen kann.
Mir gefällt sehr, dass er die Erzählung von beiden Seiten angeht, er berichtet über seine eigenen Gefühle, seinen eigenen Schockzustand, seine Wut, seine Trauer, seine Hilflosigkeit. Er erzählt, was er dafür tut, damit zurechtzukommen, um zu überleben, um mit diesem Verlust, dieser Verantwortung weiterleben zu können.
Und er erzählt vom Vater, von der gemeinsamen Zeit und seinen Erinnerungen daran. Diese Erinnerungen werden nicht beschönigt, es kommt gut heraus, dass das Vater-Sohn-Verhältnis ein eher schwieriges war und es wird auch gut begründet, warum das so war. Der Vater war ein Mensch mit Stärken und auch Schwächen, er hat viel erlebt in seiner Jugend, erlitt ein Trauma durch den Krieg, das er nie überwand und an seine Familie weiterreichte. Vieles was der Autor sich jetzt erschließt, hätte er gerne eher gewusst und mit dem Vater besprochen, das liest man aus vielen seiner Worte und kann das gut verstehen.
Der Autor und auch das Buch finden einen versöhnlichen Abschluss, der Kreis des Lebens schließt sich hier wieder und ich bin sehr dankbar, diese Geschichte erfahren zu haben.
Das Buch hat mich emotional tief berührt, zum nachsinnen angeregt und Gespräche angeregt, es hat mich traurig gemacht und mit Schmerz erfüllt, mir aber auch wieder den nötigen Trost gespendet. Eine klare Empfehlung von mir.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Völlig unverhofft ist der vor langer Zeit geheilt geglaubte Krebs von Andreas Schäfers Vater zurückgekehrt und von einem Moment auf den anderen muss die Entscheidung getroffen werden, ob die Maschinen, die ihn am Leben halten, ausgeschaltet werden sollen. Mit dem Buch „Die …
Mehr
Völlig unverhofft ist der vor langer Zeit geheilt geglaubte Krebs von Andreas Schäfers Vater zurückgekehrt und von einem Moment auf den anderen muss die Entscheidung getroffen werden, ob die Maschinen, die ihn am Leben halten, ausgeschaltet werden sollen. Mit dem Buch „Die Schuhe meines Vaters“ versucht der Autor seine Erinnerungen an seinem im Sommer 2018 verstorbenen Vater zu retten.
Sprachgewaltig und doch bildhaft, sowie nahbar, schafft es Schäfer die Erinnerungen an das Leben seines Vaters festzuhalten. Dabei beleuchtet er nicht nur die positiven Seiten, sondern das große Ganze. Er hält nicht an einem einzigen, positiven Gedanken fest, sondern an der Gesamtheit, die sich aus einem Leben voller Liebe, Rückschläge und Stolz geformt hat.
„Die Schuhe meines Vaters“ ist ein poetisches, nachdenkliches, aber auch sehr versöhnliches Buch, das Raum zur Reflexion der eigenen Lebensweise und der zwischenmenschlichen Beziehungen in unserem Leben gibt.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Geglückte Hommage an seinen Vater
„Die Schuhe meines Vaters“ ist ein sehr persönliches Buch des Autoren Andreas Schäfer, denn darin beschäftigt er sich mit dem Leben und Sterben seines eigenen Vaters. Gut erzählt macht die Geschichte nachdenklich und besticht …
Mehr
Geglückte Hommage an seinen Vater
„Die Schuhe meines Vaters“ ist ein sehr persönliches Buch des Autoren Andreas Schäfer, denn darin beschäftigt er sich mit dem Leben und Sterben seines eigenen Vaters. Gut erzählt macht die Geschichte nachdenklich und besticht durch ihre auf den Punkt gebrachte Kürze. Die Atmosphäre des Buchs ist zwar eher getragen, dennoch gefiel mir die Umsetzung gut. Der Autor erlaubt sich einen ungeschönten Blick, auch auf die schwierigen Seiten seines Vaters und reflektiert so Nebenbei auch eigene Denkweisen, sowie Erlebnisse seiner Kindheit. Vor allem die Szenen auf der Intensivstation waren für mich emotional bewegend und wirklich stark beschrieben. Aber auch die Rückblicke in die Kindheit und Jugend lasen sich interessant und stimmig. Eine besondere Freude ist außerdem der Schreibstil, welcher zwar etwas Konzentration einfordert aber durch seine feine, poetische Ausdrucksweise, ein wahrer Lesegenuss für mich war. So kommt die Geschichte auf den ersten Blick ruhig daher und entfaltet erst im Nachklang ihre ganze Wucht. Mir persönlich gefiel diese bedachte Erzählweise sehr gut und auch die zahlreichen Zeitsprünge waren für mich stimmig und sorgten für Abwechslung.
Mein Fazit: Kein Roman, welchen man einfach so nebenher liest. Hier lohnt es sich dem Buch genug Zeit und Raum zu geben. Absolute Leseempfehlung!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Wenn der Sohn über das Lebensende des Vaters bestimmen muss
Was, wenn man urplötzlich bestimmen muss, wann das Leben eines lieben Angehörigen endet?
Woher kommen wir?
Weshalb sind wir so wie wir sind?
Können wir den Spuren unserer Ahnen folgen und diese …
Mehr
Wenn der Sohn über das Lebensende des Vaters bestimmen muss
Was, wenn man urplötzlich bestimmen muss, wann das Leben eines lieben Angehörigen endet?
Woher kommen wir?
Weshalb sind wir so wie wir sind?
Können wir den Spuren unserer Ahnen folgen und diese ausfüllen?
Andreas Schäfer gelingt mit seinem aktuellen Roman "Die Schuhe meines Vaters" ein unheimlich tiefgründiges und auch emotionales Werk und gewährt uns sehr intime Einblicke in die familiären Verhältnisse, in denen er selbst aufgewachsen ist und die ihn geprägt haben.
Dreh- und Angelpunkt der Handlung ist dabei der Vater des Autors. Dieser wird von einer bereits überwunden geglaubten Krebserkrankung wieder heimgesucht und stellt sich den notwendigen Untersuchungen. Dabei gibt es Komplikationen, er erleidet eine Hirnblutung und fällt ins künstliche Koma, ohne nach Meinung der behandelnden Ärzte eine reelle Überlebenschance zu haben. Diesen tragischen Umstand teilt der Oberarzt der Neurochirurgie dem Autor mit.
Mehr möchte ich zur Story gar nicht mehr verraten sondern verweise hier nochmals auf den Klappentext.
Das Buch gliedert sich in drei Teile auf.
Im ersten steht klar der Kampf um das Leben des Vaters im Vordergrund.
Wie reagiert man, wenn einem eine solche Diagnose gestellt wird?
Vor allem wie reagiert man als nahestehender Angehöriger, der schlussendlich bestimmen muss, wann die lebenserhaltenden Maßnahmen mithilfe der Maschinen dann abgestellt werden und der letztendliche Sterbeprozess eingeleitet wird?
Dieser Teil ist unheimlich emotional geschildert und für mich der stärkste Teil im ganzen Buch. Ich wähnte mich persönlich sehr schnell mittendrin statt nur dabei und auch bei mir machte sich das beklemmende Gefühl breit, wie man wohl in einer solchen Situation dann selbst reagieren und vor allem entscheiden würde.
Ein Pfleger in der Klinik des Vaters kommt dann in breitem hessisch zu folgendem Ergebnis, ohne den Autor bei der Entscheidung drängen zu wollen:
"… aber isch wüsst, was isch tät, wenn des mein Vadder wär."
Ist die Entscheidung, einen geliebten Mitmenschen einfach von jetzt auf gleich per Befehl gehen zu lassen, wirklich so einfach?
Welche Gedanken gehen einem dabei im Kopf herum bzw. welche Umstände versucht man abzuwägen?
Im zweiten Teil spürt der Autor dann dem Leben seines Vaters entsprechend nach und geht in Gedanken nochmals einige wichtige Stationen seines Lebens durch. Genau dabei lernt man dann den Vater nochmals aus einer ganz anderen Perspektive kennen. Für den Autor selbst ist es vielleicht auch eine Art mit seinem Vater reinen Tisch zu machen und sich mit ihm und seinem damaligen nicht immer galanten Verhalten auszusöhnen.
Zum Schluss bricht der Autor dann zu einer insgesamt versöhnlichen Reise auf.
Das autobiographische Werk ist unheimlich gut umgesetzt, ohne allzu voyeuristisch zu wirken. Der Blick des Autors auf seinen Vater ist nicht verklärt sondern er schildert aus den eigenen Erinnerungen heraus und anhand der Aufzeichnungen seines Vaters, von dessen Leben in seiner kompletten Fülle mit allen Höhen und Tiefen.
Insgesamt ist es ein Werk, das einen selbst über die eigenen familiären Beziehungen nachdenken lässt. Insbesondere die gottgleiche Entscheidung im ersten großen Teil des Romans, wann ein Leben dann wirklich zu Ende ist, lässt mich persönlich arg nachdenklich zurück.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
In "Die Schuhe meines Vaters" ist Andreas Schäfer auf knapp 200 Seiten ein bewegendes und wortgewaltiges Denkmal seines verstorbenen Vaters gelungen. Es ist ein Erinnern an den Vater und die gemeinsam verbrachte Zeit, eine ehrliche Reflexion über die nicht immer einfache …
Mehr
In "Die Schuhe meines Vaters" ist Andreas Schäfer auf knapp 200 Seiten ein bewegendes und wortgewaltiges Denkmal seines verstorbenen Vaters gelungen. Es ist ein Erinnern an den Vater und die gemeinsam verbrachte Zeit, eine ehrliche Reflexion über die nicht immer einfache Vater-Sohn-Beziehung und auch eine Reise zu sich selbst. Es ist kein verklärtes Porträt des Vaters, der seine Eigenheiten hatte und nicht ohne Fehler war, der Autor ist schonungslos offen über sich und seinen Vater und ihr zwiespältiges Verhältnis zueinander, aber dennoch ist die Liebe zum Vater und die Trauer und der Schmerz über seinen Tod deutlich spürbar. Er zeichnet den Vater so wie er in Erinnerung hat und schafft so ein authentisches und bewegendes Bild von einem Mann, der sich für Kunst interessierte, gern reiste und eher ein Einzelgänger war.
In drei Kapiteln wird vom Tod des Vaters, der nach einer eine Hirnblutung in ein Koma fällt und nur noch von Maschinen am Leben erhalten wird, von der Kindheit des Vaters und seinem späteren Leben sowie der versöhnlichen Annäherung des Sohnes mit dem Vater erzählt. Besonders das erste Kapitel, das kurz die Zeit vor der Operation und dann die Zeit nach der Operation und der Hirnblutung erzählt, ist emotional sehr bewegend und traurig. Der Schock, das Nicht-wahr-haben-wollen, das Verdrängen und schließlich die Konfrontation mit dem Tod des Vaters ist nicht leicht zu lesen, aber sprachlich toll umgesetzt. Die Beklemmung und Ohnmacht ist förmlich spürbar. Auch die literarische Aufarbeitung und Rekonstruktion der Lebensgeschichte des Vaters von dessen Kindheit in Berlin an während des zweiten Weltkrieges über das Gründen einer eigenen Familie bis zur Scheidung und die Zeit danach kann durch den fesselnden und poetischen Schreibstil überzeugen. Noch mal sehr persönlich wird es im letzten Kapitel, als es auf einer Griechenlandreise zur Aussöhnung mit dem verstorbenen Vater kommt.
Alles in allem, eine sehr persönliche, bewegende und melancholische Annäherung und Würdigung des toten Vaters, die durch ihre bildliche und ausdrucksstarke Sprache zu überzeugen weiß. Lesenswert!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Der Ungreifbare
Nach dem erfolgreichen Roman „Das Gartenzimmer“ begibt sich Andreas Schäfer nun mit „Die Schuhe meines Vaters“ auf die ergreifende literarische Erinnerungskonstruktion und Annäherung an seinen im Jahr 2018 verstorbenen Vater. Nachdem Schäfer …
Mehr
Der Ungreifbare
Nach dem erfolgreichen Roman „Das Gartenzimmer“ begibt sich Andreas Schäfer nun mit „Die Schuhe meines Vaters“ auf die ergreifende literarische Erinnerungskonstruktion und Annäherung an seinen im Jahr 2018 verstorbenen Vater. Nachdem Schäfer zwei Jahre nach dem Tod bemerkt, dass ihm das Gesicht des ungreifbaren Vaters verlorengeht und seine Erinnerungen an ihn immer weniger werden, setzt er ihm ein faszinierendes, schriftstellerisches Denkmal, in dem der Autor selbst mit auf eine bewegende und scharf beobachtete Zeitreise in seine Kindheit und Jugend geht und auch über transgenerationale Traumata nachdenkt.
In drei kunstvollen Teilen setzt Schäfer nicht nur ein unsentimentales, poetisches und philosophisches Bild des Erinnerungsvaters und das meist komplizierte emotionale Miteinander zusammen, sondern ordnet und gliedert sehr klug auch die zeitlichen, historischen Rahmenbedingungen außenherum – Kriegstraumata im Zweiten Weltkrieg, ein brennendes Elternhaus im zerbombten Berlin, ein verstoßener Sohn, eine Ehe mit einer Griechin, die in die Brüche geht und ein eigenbrötlerisches Leben in einem Hochhaus in Frankfurt/Main mit vielen Reisen in die Welt und auf zahlreiche griechische Inseln.
Andreas Schäfer beginnt seine assoziativen und weise zusammengesetzten Erinnerungsaufzeichnungen mit einer ethischen und sehr berührenden Frage: Wann sollen die Maschinen, die den gehirntoden, im künstlichen Koma liegenden Vater nach einem fehlgeschlagenen Biopsie-Eingriff am Leben erhalten, abgeschaltet werden? Mutter und Sohn ringen gemeinsam nach einer Antwort im Krankenhaus, während Erzähler Schäfer die Schuhe des Vaters zurück in die Wohnung bringt und anhand von Reiseaufzeichnungen, Erinnerungen, persönlichen Gegenständen und sehr klugen Reflexionen das unstetige, vereinnahmende und stets gekränkte Wesen des Vaters zu rekonstruieren versucht und dabei auch seine eigenen ambivalenten Gefühle wie verborgene Zuneigung und tiefe Scham miteinbezieht. Während die Familie zusammen beschließt, den Vater gehen zu lassen, erzählt Schäfer vom deutsch-griechischen Familienalltag in Frankfurt am Main, von Zerwürfnissen und Annäherungen, von Verletzungen und Freuden, vom Krieg und einer möglichen Versöhnung mit dem innerlich nervösen und zerrissenen Vater.
„Die Schuhe meines Vaters“ ist ein sehr lebenserfahrenes, psychologisch messerscharf fragendes und zutiefst einfühlsames Buch, das vom Abschiednehmen, von Trauer, aber auch vom Einordnen des eigenen Lebens erzählt – und dabei anhand von scheinbar kleinen Details größere existenzielle Dinge einkreist und erhellt. Der behutsame und bewegende dritte Teil des Buches, in dem Schäfer auf der griechischen Insel Naxos den Berg Zas besteigt und dem Geist des Vaters begegnet, trifft ins Herz und spricht von einem hoffnungsvollen und versöhnlichem Loslassen. Gelungen zusammengesetzte und sehr lesenswerte Erinnerungsstücke und Reflexionen, die tief zum Sinnieren anregen.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch Ein zutiefst berührendes und auch versöhnliches Buch über die Trauer.
✎
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Kein Roman, sondern eine intime Rekonstruktion der Beziehung zum Vater, eine Betrachtung des Mannes von der Kindheit bis zum Tod, eine Annäherung an diesen starken, widersprüchlichen, intensiven, schwer zugänglichen Vater.
Andreas Schäfer lässt uns teilhaben an dieser …
Mehr
Kein Roman, sondern eine intime Rekonstruktion der Beziehung zum Vater, eine Betrachtung des Mannes von der Kindheit bis zum Tod, eine Annäherung an diesen starken, widersprüchlichen, intensiven, schwer zugänglichen Vater.
Andreas Schäfer lässt uns teilhaben an dieser Spurensuche. Schonungslos, teilweise auch extrem detailliert und offen, lernen wir den Vater Robert kennen, der kaum tiefere Kontakte zu seinen Mitmenschen aufbauen kann, obwohl er so kommunikativ und unterhaltsam ist. Als Kind in seiner Heimatstadt Berlin ausgebombt, schon früh sein Elternhaus und die gewohnte Umgebung verloren, wird er ein Getriebener, immer unterwegs, voller Begeisterung für Literatur, Kunst, Kultur, für das Wahre und Schöne, das Reisen und Erkunden, das akribisch vorbereitet wird. Die Beziehung zu seinen beiden Söhnen und seiner griechischen Ehefrau ist wechselhaft, teils intensiver, teils wieder durch Entfremdung geprägt, aber immer wieder auch mit Bewunderung und Zuneigung verbunden.
Letztendlich geht es um das Abschiednehmen vom Vater, der plötzlich einen Hirntod erleidet und nun von den lebensrettenden Maschinen wieder entkoppelt werden muss. Diese Entscheidung müssen die Angehörigen treffen und es ist eigentlich keine Frage nach dem „ob“, sondern nach dem „wann“ und bei diesem Warten und Sich-Anfreunden mit dem Tod ergeben sich diverse Fragen und die Vater-Sohn-Beziehung wird im Nachhinein neu betrachtet, analysiert und bewertet.
Eine literarische Biographie, die dem Leser die Augen für die eigene Vater-Kind-Beziehung öffnen kann, die anregt, Familienstrukturen zu überdenken, eventuell auch Schritte zu unternehmen, die eine Wiederannäherung ermöglichen. Ein nachdenkliches Buch über Verlust, Fernweh, Verstoßen-Werden, Rastlosigkeit, Sehnsüchte und Träume, Wut, innere Ruhe, Anerkennung – die Unbehaustheit eines Exzentrikers. Trotz allem ist das Buch versöhnlich und am Ende begibt sich der Autor nach einer Dusche / Reinigung auf die Suche nach seiner Familie, Frau und Tochter, Repräsentanten der nächsten Genration.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
eine bewegende geschichte aus dem leben. der sohn setzt sich mit dem leben und sterben, mit krankheit und tod seines vaters auseinander. viele rückblicke über erlebnisse der beiden fliessen ein und veranschaulichen die beziehung. sehr gut sind die gedanken und gefühle beschrieben. ein …
Mehr
eine bewegende geschichte aus dem leben. der sohn setzt sich mit dem leben und sterben, mit krankheit und tod seines vaters auseinander. viele rückblicke über erlebnisse der beiden fliessen ein und veranschaulichen die beziehung. sehr gut sind die gedanken und gefühle beschrieben. ein sehr lesenswertes buch, das mich berührt und zum nachdenken angeregt hat.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für