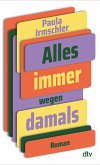Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.

Uwe Tellkamps neues Buch "Die Schwebebahn" spielt wie "Der Turm" in Dresden. Dem Flaneur wird die Stadt dabei zum Medium der Erinnerung - auch an die eigene Kindheit.
Geht man im Winter durch Dresden, wird man nicht immer bester Dinge sein: Die Straßen sind breit, die Wege lang und die Abstände zwischen den Häusern meist so groß, so dass Wind und Kälte wie in der Landschaft zu spüren sind. Für Uwe Tellkamp, der 1968 in Dresden geboren wurde, hier aufwuchs und nach Studien- und Berufsjahren in Leipzig, New York und München 2004 in seine Heimatstadt zurückkehrte, ist die Weite kein Problem. Er liebt die Stadt als Spaziergänger gerade im Winter. "Das Dresden meines Temperaturgedächtnisses", so lautet der erste Satz des neuen Buches, "ist eine Winterstadt voller Fernwärmerohre und Heizungen, von deren Rippen die Farbe abgeplatzt war."
Dass der Autor der "Dresdner Erkundungen" trotz aller Begeisterung für seine Stadt keine touristischen Zwecke verfolgt, wird beim Weiterlesen schnell deutlich. Erinnerung ist das Verfahren, mit dem sich Tellkamp die städtischen Orte aneignet, auch wenn topographische Hinweise vielfach den Ausgangspunkt bilden: "Für den Jungen, der ich war, gab es kaum einen anziehenderen Ort als den Dachboden der Oskar-Pletzsch-Straße 11, Weißer Hirsch, das zweite Haus, nach einem Johannstädter Plattenbau, das auf mich den Eindruck einer Persönlichkeit machte. Wenn die Winde schnauften und das Schneegestöber weiße Mauern um den Elbhang wachsen ließ, knarrten die Dachbalken, als gehörten sie zur ,Hispaniola', dem Schatzinselsegler".
Tellkamp schlägt in diesem zweiten Absatz eine Brücke zu seinem 2008 erschienenen Erfolgsroman "Der Turm", in dem er das Leben des Dresdner Bildungsbürgertums über den Elbhängen in den letzten Jahren der DDR beschreibt. Während die Hauptfigur zu Beginn des Romans mit der Standseilbahn zum Haus der Eltern hinauffährt und sich damit von der Stadt entfernt, nimmt Tellkamp nun die nahe gelegene Schwebebahn zum Titel. Auch dies ist mit Bedacht gewählt. Denn der Aussichtspunkt, zu dem die Bahn führt, ist der Stadt zugewandt und hat mit den Lebensbedingungen des "Turm" nur wenig zu tun. So ist Tellkamps neues Buch keine Fortsetzung des vorausgehenden, sondern bietet einen neuen Blick auf die räumlichen Konstellationen seiner Lebensgeschichte.
Erzähltechnisch knüpft der Autor an seinen zweiten Roman "Der Schlaf aus den Uhren" an. Von ihm ist nur jener Auszug veröffentlicht, für den er 2004 den Klagenfurter Ingeborg-Bachmann-Preis bekommen hat. Auch hier gibt es keine episch konstituierte Handlung, wie in den anderen Romanen, dem Erstlingswerk "Der Hecht, die Träume und das Portugiesische Café" (2000) sowie dem "Eisvogel" (2005). Vergegenwärtigt werden vielmehr fragmentierte Erinnerungen, die der Ich-Erzähler mit Häusern, Plätzen oder Inschriften bei einer Straßenbahnfahrt durch Dresden verbindet (abgedruckt in "Die Besten - Klagenfurter Texte 2004").
Dennoch ist die "Schwebebahn" keine Wiederaufnahme des unveröffentlichten Romans. Zwar tauchen schon im Klagenfurter Text Ortsteile, Ereignisse und Produktnamen auf, denen man auch in der "Schwebebahn" begegnet, doch geht es hier ruhiger zu, da der Erzähler in erster Linie als Spaziergänger unterwegs ist und sich für Orte und Erinnerungen Zeit nimmt. Beschreibungen, die dem ortsunkundigen Leser Orientierung bieten, liefert das Buch allerdings selten, denn der Autor interessiert sich vor allem für solche Phänomene, denen kein anderer Beachtung schenkte oder die es nicht mehr gibt, weil sie nach der Wende von 1989 verschwunden sind: Häuser wie das Lazarett der Roten Armee, Industrieprodukte wie die Schuhcreme "Eg-Gü" oder das Artikulations- und Bewegungsspiel "Frau Ludwigs Trabant", das der Vater zur Freude des Sohnes vorführt.
Tellkamp zeigt also ein ausgeprägtes Interesse für das "Jüngstvergangene" und den "Abfall" der Kultur, das Walter Benjamin in einem 1929 veröffentlichten Essay als Grundimpuls des Surrealismus identifiziert hat: "Er zuerst stieß auf die revolutionären Energien, die im ,Veralteten' erscheinen, in den ersten Eisenkonstruktionen, den ersten Fabrikgebäuden, den frühesten Photos, den Gegenständen, die anfangen auszusterben."
Tellkamp folgt der Idee. Er ist fasziniert von ungewöhnlichen Dienstleistungen, Waren und Industriebauten, zu denen nicht zuletzt die Schwebebahn gehört.
Aber auch weniger attraktive Gebäude werden eingehend charakterisiert: "Die Fleischfabrik: eine gemauerte Schnecke. Eisenrippen unter roher Ziegelverkleidung, dem Schwung der Fabrikstraße folgende Fassaden, die mit Holz verschalte Glaskuppel, früher zu Reklamezwecken beleuchtet." Sieht man von Martin Mosebachs Roman "Westend" ab, gibt es in der neueren deutschen Literatur kein anderes Werk, in dem ein Autor so viel Gespür für Architekturformen zeigt und deren Eigenheiten in Sprache zu bringen vermag. Deshalb ist Tellkamps "Schwebebahn" nicht nur ein surrealistisches Buch über seine Heimatstadt, sondern zugleich eine hohe Schule des Sehens jenseits der Bilder, die Reiseführer und repräsentative Werke zu bieten haben.
Der assoziative Umgang mit der sichtbaren Wirklichkeit und die Aufwertung vernachlässigter Kulturphänomene sind nicht die einzigen Darstellungsweisen, die Tellkamps Buch zu einem legitimen Nachfolger des Surrealismus werden lassen. Wie André Bretons "Nadja" und Louis Aragons "Le paysan de Paris", mit denen die surrealistische Bewegung ein größeres Publikum fand, enthält auch Tellkamps Buch realistische Fotografien, die nicht in einem illustrativen Zusammenhang mit dem Text stehen, sondern eigene Aussagekraft entfalten. Es handelt sich um Aufnahmen von Werner Lieberknecht, die in fünfundzwanzig Jahren entstanden sind.
Auch die Idee des Flaneurs, dem die Stadt zur Landschaft und zum Medium der Erinnerung an die Kindheit wird, hat Tellkamp von den Surrealisten übernommen. Benjamin verdeutlicht das Verfahren in einer Rezension zu Franz Hessels Buch "Spazieren in Berlin", aus dem auch Tellkamp gelernt haben dürfte: "Als Einheimischer zum Bild einer Stadt zu kommen, erfordert andere, tiefere Motive. Motive dessen, der ins Vergangene statt in die Ferne reist, . . . ein Echo von dem, was die Stadt dem Kinde von früh auf erzählte." Der Flaneur werde damit zum "Priester des genius loci", eine Rolle, in die auch Tellkamp geschlüpft ist.
Dennoch geht die literarische Verfahrensweise der "Schwebebahn" in einer Poetik des surrealistischen Romans nicht auf. Der Autor historisiert vielmehr seine Wahrnehmungen, indem er die dreiunddreißig Kapitel teils unmerklich, teil durch konkrete Angaben auf seine Biographie bezieht. Das Buch beginnt mit den Erinnerungen eines Jungen "von zehn oder elf Jahren" um 1978/79 und endet nach mehr als dreißig Jahren in der unmittelbaren Gegenwart kurz vor Abschluss des Buches mit Aussagen über die Zukunft: "Es wird zurückkehren, das Geräusch der ,Hispaniola', nachts, wenn im Dachbodenschatten Flints Mannschaft lauscht, doch das Haus ruhig ist und die Positionslampe im Dachfirst allmählich in die Koordinaten des Polarsterns rückt."
Aus Gaston Bachelards "Poetik des Raumes" weiß man, dass Aufenthalte des Kindes auf dem Dachboden zu den "Bildern des glücklichen Raumes" gehören; Tellkamps "Schwebebahn" lässt deutlich werden, dass solche Bilder auch durch eine Winterstadt hervorgerufen werden können - und dies vielleicht ein Leben lang.
DETLEV SCHÖTTKER
Uwe Tellkamp: "Die Schwebebahn". Dresdner Erkundungen.
Mit Fotografien von Werner Lieberknecht. Insel Verlag, Berlin 2010. 177 S., geb., 19,90 [Euro]
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH