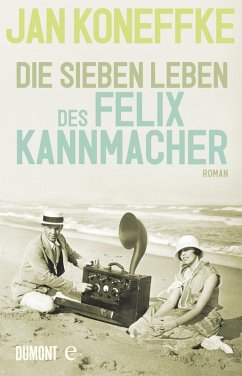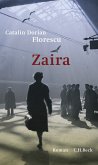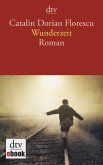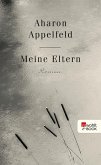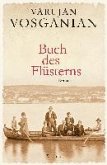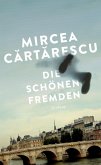In einer Zeit, in der niemand sicher sein kann, wen er vor sich hat, ist sich der Held dieses Romans nicht sicher, wer er selbst ist: Felix Kannmacher oder Johann Gottwald. Im Herbst 1934 wird Felix Kannmacher vom Pianisten Victor Marcu aus dem Deutschen Reich geschmuggelt und erhält in Bukarest eine neue Identität. Als Johann Gottwald wird er die ›Kinderfrau‹ von Marcus Tochter Virginia, bei der er sich schnell als großer Geschichtenerzähler beliebt macht. Als die Freundschaft zwischen beiden enger wird, entlässt ihn der eifersüchtige Vater, und plötzlich ist Kannmacher ganz allein in einem fremden Land. Und so schlägt er sich unter falschem Namen durch: als Kellner im größten Kasino von Bukarest, er arbeitet als Sekretär für die Nazis und versteckt sich in einem Kloster im Karpatenland. Doch in jeder Identität, die sein Schicksal ihm gerade aufbürdet, immer bleibt die Verbindung zwischen ihm und Virginia bestehen, die bald zu einer berühmten Schauspielerin heranwächst. ›Die sieben Leben des Felix Kannmacher‹ ist ein historisches Schelmenstück, ein Hohelied auf die Liebe und ein berührendes Künstlerepos zugleich.
Stirb an einem anderen Tag
Jan Koneffke erzählt von Liebe, Verrat und Tod: "Die sieben Leben des Felix Kannmacher"
Das sagt sich immer so leicht und etwas unverbindlich dahin: dass einem Roman die Lust am Erzählen und Fabulieren anzumerken sei. Wobei dann meist vergessen wird, dass es ja nicht einfach ums muntere Draufloserzählen geht. Es muss recherchiert, es muss Material gesammelt und ausgemustert werden, es braucht Timing und Ökonomie, es muss ausladend sein und doch konzentriert und nicht geschwätzig. Leichtigkeit ist halt das Produkt harter Arbeit, und die Fülle entsteht aus der Kunst der Verknappung.
An dem Roman "Die sieben Leben des Felix Kannmacher" lässt sich das sofort sehen. Die Vorarbeiten reichten zehn Jahre zurück, sagt Jan Koneffke, der in einem kleinen Ort am Fuße der Karpaten sitzt, als wir telefonieren. Was auch schon teilweise die Frage beantwortet, warum ein deutscher Schriftsteller einen Roman im Bukarest der dreißiger und vierziger Jahre spielen lässt. Koneffke, 50, der lange in Rom gelebt hat, hat jetzt einen Wohnsitz in Bukarest und einen in Wien, er übersetzt aus dem Rumänischen, und er hat in seinem Roman gewissermaßen ein Stück seiner Familiengeschichte ins Rumänische übersetzt.
Der Familienname Koneffke, sagt er, leite sich vom polnischen oder kaschubischen Wort "koneffka" her: Gießkanne. Deshalb heißt der Held Kannmacher, und wer Koneffkes Roman "Eine nie vergessene Geschichte" (2008) gelesen hat, kennt Felix Kannmacher als einen jungen Mann aus Pommern, der eine Doppelhochzeit platzen ließ und dessen Spur sich anschließend verlor. Statt, wie Koneffkes realer Großonkel, in Ungarn abzutauchen, landet er eben 1934 in Rumänien, wo noch König Carol II. regiert, die nationalistische Eiserne Garde an die Macht drängt und wo man mit Nazi-Deutschland sympathisiert.
Der Erzähler der "Nie vergessenen Geschichte" hatte über seinen verschollenen Großonkel gesagt: "Ich werde sein Leben erfinden." Er hat nicht zu viel versprochen. Die Fiktion, die bereits dieser Roman-Onkel war, fiktionalisiert sich selbst. Der erste Satz des neuen Buches ist das Echo des letzten Satzes im alten Buch: "Heute kommt es mir vor, als sei meine Erinnerung eine erfundene Geschichte." Aber man muss den Vorgängerroman gar nicht kennen, um den Weg in die "Sieben Leben" zu finden. Die Ich-Erzählung ist eine Konstruktion, die sich selber trägt, was auch gut zu diesem Helden passt.
Felix Kannmacher hat keinen Lebensplan und keinen festen Boden. 1934, im Berliner Nikolaiviertel, bei einer Razzia, haben ihm SA-Männer zwei Finger zertreten, weil der Besitzer des Lokals, in dem er Klavier spielte, Jude war. Nach Bukarest hat es ihn verschlagen, weil er einen international berühmten rumänischen Pianisten kennt, der ihn im Kofferraum über die Grenze geschmuggelt, ihm falsche Papiere besorgt und als "Kinderfrau" seiner 13-jährigen Tochter angestellt hat. So ist aus Felix Kannmacher Johann Gottwald geworden, ein falscher Siebenbürger Sachse, und er ist einer dieser Romanhelden, die weniger agieren, als dass es sie ständig irgendwohin verschlägt im Leben; ein Außenseiter, ein Abenteurer wider Willen, mehr Überlebens- als Lebenskünstler, ein verhinderter Pianist ohne Beruf - aber ganz bestimmt nicht der "Taugenichts" im "Schelmenroman", zu dem der Klappentext ihn macht.
Wenn er auf sein Leben blickt, sagt Felix, sehe er nur ein "sinnloses Taumeln und Stolpern". Er weiß es - aber er kann es nicht besser. Und statt "Die sieben Leben", sagt Koneffke, hätte das Buch auch "Die sieben Tode" heißen können, was allerdings deutlich weniger einladend geklungen hätte. Jetzt denkt jeder natürlich an die sprichwörtliche Katze, weil auch Felix immer wieder auf den Füßen landet. Irgendwie jedenfalls, gebeutelt, geschunden, todtraurig, knapp davongekommen, aber mit einem ausgeprägten Selbsterhaltungswillen, auch wenn er oft nicht weiß, wer das denn nun sein soll: sein Selbst.
Er lebt weiter - und stirbt an einem anderen Tag. Marcu, der große Pianist und noch größere Selbstüberschätzer, entlässt ihn, aber Felix hat sich unsterblich verliebt in Marcus Tochter Virginia, die natürlich viel zu jung ist für den Dreißigjährigen. Die große Liebe bleibt sie dennoch, und wenn ihn etwas hält, wenn es einen schwachen Kompass gibt in seinem Leben, dann Virginia. In den politischen Tumulten der späten dreißiger und vierziger Jahre mogelt er sich durch, arbeitet als Saalchef im Casino, entgeht erst den Nazis, aber dann doch dem Nazi-Onkel nicht, der ihn für sich einzuspannen versucht. Er überlebt ein Erdbeben und versteckt sich in einem Kloster in den Karpaten. Und als die Sowjets in Rumänien einziehen, wird er als vermeintlicher Nazi inhaftiert, gefoltert, verurteilt, um sich schließlich nach Wien zu retten. Das hört sich jetzt so geradlinig an und ist doch ein wild mäandernder Lebenslauf, ein Weg voller Seitenpfade, Sackgassen und Fallgruben.
Koneffke ist nun kein Autor, dem Literaturpreisjurys, wie im Tüv-Protokoll, aufgerauhte Sprachoberflächen bescheinigen oder Metafiktion mit hoher Drehzahl. Er ist einer, der die Fülle seines Stoffs so großzügig wie gut dosiert ausbreitet und 500 Seiten lang Geschichten und Geschichten in Geschichten erzählt, die nie langweilen. Politik und Zeitgeschichte, Liebe und Tragödie, Krieg und Kunst - es fehlt an nichts, aber vor allem ist da kein sogenanntes großes Thema, zu dem dann mühsam passende Charaktere geschnitzt werden müssen.
Es geht einem wie vor überdimensionalen, überbordenden Gemälden, auf denen, bei genauem Hinsehen, jeder seinen Platz hat und auf seine Weise unentbehrlich ist - der Pope mit dem Schnapsatem und die Tante mit der Schwäche für Kompott und Suchard-Schokolade, der großmäulige Maler im paradiesischen Seebad Baltschik am Schwarzen Meer und die vielen Geliebten des Helden. Koneffkes Stärke ist die Anschaulichkeit seiner Prosa, die Bildhaftigkeit, die sich mit den Personen und Schauplätzen wie von selbst einzustellen scheint. Man erfährt, was auf den Tisch kommt und was beim Essen unterm Tisch passiert, welche Kleider getragen und welche Intrigen gesponnen werden, welche Gefühle die Charaktere umtreiben, wie es in ihren Wohnungen aussieht und in welchen Phantasmagorien sie wohnen. Es gibt Szenen voller irrwitziger Komik und voller Grausamkeit; es ist nicht das unverdrossene, augenzwinkernde Fabulieren, es fließt Blut, es gibt Verrat und Tod. Denn wenn einer sieben Leben haben soll, muss er dafür eben auch sieben Tode sterben.
Mag ja sein, dass es etwas Altmodisches hat, einfach zu erzählen, ohne sich ständig an der Unmöglichkeit des Erzählens zu reiben. Mag auch sein, dass es hilft, wenn einer so etwas wie eine Poetologie hat oder selbstreferentielle Pirouetten dreht, aber das bringt nicht wirklich weiter, wenn man nicht weiß, wie daraus zwingende Prosa wird. Bei Jan Koneffke sieht das alles ganz einfach aus. Selbstreflexion ist da nur eine Frage des geglückten Dialogs: ",Warum erfindet man eine Geschichte?', verlangte er von mir zu wissen. ,Um keine Geisel der Zeit mehr zu sein', sagte ich, wieder sicherer werdend. ,Wer Geschichten erfindet, der kann sie verlangsamen oder beschleunigen, dehnen oder stauchen. Er kann sie umkehren, anhalten, stillstellen, wenn er sich von einer Erinnerung nicht trennen will, einem Gesicht, einem Menschen. Nichts ist unwiderruflich und nichts, was sich in der Vergangenheit abspielte, notwendig. Seine Geschichte beginnt an dem fernen Punkt in der Vergangenheit, als nichts entschieden war und das Leben noch einen ganz anderen Verlauf nehmen konnte.'"
Koneffke hat, weil er sich, wie sein Held, mit der eisernen Notwendigkeit langweilt, einen Hang zum Märchenhaften, zum Phantastischen. Und indem er ihm nachgibt, wirkt die zerstückelte Biographie seines Protagonisten schon wieder normal im Vergleich zu den Geschichten, die sich dieser Felix ausdenkt, für jene Menschen, die ihm nahe sind. Wenn einer vom "goldenen Wal in den Bergen" erzählt, von einer preußischen Riesenkanone oder vom osmanischen Meisterdieb, der elf Sultane überlebte, ist es völlig glaubwürdig, dass Felix nach einem Erdbeben samt Resten seines Zimmers aus dem zehnten Stock auf der Straße steht.
Er habe beim Schreiben bisweilen an "1001 Nacht" gedacht, sagt Koneffke, vor allem wegen der balkanischen Schnittstelle zwischen Okzident und Orient, gelegentlich auch an den dauerstaunenden Simplicissimus; doch viel entscheidender ist, dass er diesen Felix, dessen Namen ein böses Omen ist, in eine Welt versetzt, die vom Geschichtenerzählen lebt - wobei Wahrheit oder Wahrscheinlichkeit dieser Geschichten weit weniger wichtig sind, als dass sie so gut erzählt sind, dass beim Lesen ein unwiderstehlicher Sog entsteht. Das erinnert von ferne an den Satz von Max Frisch: "Jeder Mensch, nicht nur der Dichter, erfindet seine Geschichten - nur dass er sie, im Gegensatz zum Dichter, für sein Leben hält." Und weil diese Geschichten auch noch ein Fenster in eine fremde, ferne Zeit aufstoßen, klappt man am Ende nicht einfach ein Buch zu, sondern taucht auf aus einer anderen Welt.
PETER KÖRTE.
Jan Koneffke: "Die sieben Leben des Felix Kannmacher". Roman. Dumont-Buchverlag, 510 Seiten, 19,99 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Jan Koneffke erzählt von Liebe, Verrat und Tod: "Die sieben Leben des Felix Kannmacher"
Das sagt sich immer so leicht und etwas unverbindlich dahin: dass einem Roman die Lust am Erzählen und Fabulieren anzumerken sei. Wobei dann meist vergessen wird, dass es ja nicht einfach ums muntere Draufloserzählen geht. Es muss recherchiert, es muss Material gesammelt und ausgemustert werden, es braucht Timing und Ökonomie, es muss ausladend sein und doch konzentriert und nicht geschwätzig. Leichtigkeit ist halt das Produkt harter Arbeit, und die Fülle entsteht aus der Kunst der Verknappung.
An dem Roman "Die sieben Leben des Felix Kannmacher" lässt sich das sofort sehen. Die Vorarbeiten reichten zehn Jahre zurück, sagt Jan Koneffke, der in einem kleinen Ort am Fuße der Karpaten sitzt, als wir telefonieren. Was auch schon teilweise die Frage beantwortet, warum ein deutscher Schriftsteller einen Roman im Bukarest der dreißiger und vierziger Jahre spielen lässt. Koneffke, 50, der lange in Rom gelebt hat, hat jetzt einen Wohnsitz in Bukarest und einen in Wien, er übersetzt aus dem Rumänischen, und er hat in seinem Roman gewissermaßen ein Stück seiner Familiengeschichte ins Rumänische übersetzt.
Der Familienname Koneffke, sagt er, leite sich vom polnischen oder kaschubischen Wort "koneffka" her: Gießkanne. Deshalb heißt der Held Kannmacher, und wer Koneffkes Roman "Eine nie vergessene Geschichte" (2008) gelesen hat, kennt Felix Kannmacher als einen jungen Mann aus Pommern, der eine Doppelhochzeit platzen ließ und dessen Spur sich anschließend verlor. Statt, wie Koneffkes realer Großonkel, in Ungarn abzutauchen, landet er eben 1934 in Rumänien, wo noch König Carol II. regiert, die nationalistische Eiserne Garde an die Macht drängt und wo man mit Nazi-Deutschland sympathisiert.
Der Erzähler der "Nie vergessenen Geschichte" hatte über seinen verschollenen Großonkel gesagt: "Ich werde sein Leben erfinden." Er hat nicht zu viel versprochen. Die Fiktion, die bereits dieser Roman-Onkel war, fiktionalisiert sich selbst. Der erste Satz des neuen Buches ist das Echo des letzten Satzes im alten Buch: "Heute kommt es mir vor, als sei meine Erinnerung eine erfundene Geschichte." Aber man muss den Vorgängerroman gar nicht kennen, um den Weg in die "Sieben Leben" zu finden. Die Ich-Erzählung ist eine Konstruktion, die sich selber trägt, was auch gut zu diesem Helden passt.
Felix Kannmacher hat keinen Lebensplan und keinen festen Boden. 1934, im Berliner Nikolaiviertel, bei einer Razzia, haben ihm SA-Männer zwei Finger zertreten, weil der Besitzer des Lokals, in dem er Klavier spielte, Jude war. Nach Bukarest hat es ihn verschlagen, weil er einen international berühmten rumänischen Pianisten kennt, der ihn im Kofferraum über die Grenze geschmuggelt, ihm falsche Papiere besorgt und als "Kinderfrau" seiner 13-jährigen Tochter angestellt hat. So ist aus Felix Kannmacher Johann Gottwald geworden, ein falscher Siebenbürger Sachse, und er ist einer dieser Romanhelden, die weniger agieren, als dass es sie ständig irgendwohin verschlägt im Leben; ein Außenseiter, ein Abenteurer wider Willen, mehr Überlebens- als Lebenskünstler, ein verhinderter Pianist ohne Beruf - aber ganz bestimmt nicht der "Taugenichts" im "Schelmenroman", zu dem der Klappentext ihn macht.
Wenn er auf sein Leben blickt, sagt Felix, sehe er nur ein "sinnloses Taumeln und Stolpern". Er weiß es - aber er kann es nicht besser. Und statt "Die sieben Leben", sagt Koneffke, hätte das Buch auch "Die sieben Tode" heißen können, was allerdings deutlich weniger einladend geklungen hätte. Jetzt denkt jeder natürlich an die sprichwörtliche Katze, weil auch Felix immer wieder auf den Füßen landet. Irgendwie jedenfalls, gebeutelt, geschunden, todtraurig, knapp davongekommen, aber mit einem ausgeprägten Selbsterhaltungswillen, auch wenn er oft nicht weiß, wer das denn nun sein soll: sein Selbst.
Er lebt weiter - und stirbt an einem anderen Tag. Marcu, der große Pianist und noch größere Selbstüberschätzer, entlässt ihn, aber Felix hat sich unsterblich verliebt in Marcus Tochter Virginia, die natürlich viel zu jung ist für den Dreißigjährigen. Die große Liebe bleibt sie dennoch, und wenn ihn etwas hält, wenn es einen schwachen Kompass gibt in seinem Leben, dann Virginia. In den politischen Tumulten der späten dreißiger und vierziger Jahre mogelt er sich durch, arbeitet als Saalchef im Casino, entgeht erst den Nazis, aber dann doch dem Nazi-Onkel nicht, der ihn für sich einzuspannen versucht. Er überlebt ein Erdbeben und versteckt sich in einem Kloster in den Karpaten. Und als die Sowjets in Rumänien einziehen, wird er als vermeintlicher Nazi inhaftiert, gefoltert, verurteilt, um sich schließlich nach Wien zu retten. Das hört sich jetzt so geradlinig an und ist doch ein wild mäandernder Lebenslauf, ein Weg voller Seitenpfade, Sackgassen und Fallgruben.
Koneffke ist nun kein Autor, dem Literaturpreisjurys, wie im Tüv-Protokoll, aufgerauhte Sprachoberflächen bescheinigen oder Metafiktion mit hoher Drehzahl. Er ist einer, der die Fülle seines Stoffs so großzügig wie gut dosiert ausbreitet und 500 Seiten lang Geschichten und Geschichten in Geschichten erzählt, die nie langweilen. Politik und Zeitgeschichte, Liebe und Tragödie, Krieg und Kunst - es fehlt an nichts, aber vor allem ist da kein sogenanntes großes Thema, zu dem dann mühsam passende Charaktere geschnitzt werden müssen.
Es geht einem wie vor überdimensionalen, überbordenden Gemälden, auf denen, bei genauem Hinsehen, jeder seinen Platz hat und auf seine Weise unentbehrlich ist - der Pope mit dem Schnapsatem und die Tante mit der Schwäche für Kompott und Suchard-Schokolade, der großmäulige Maler im paradiesischen Seebad Baltschik am Schwarzen Meer und die vielen Geliebten des Helden. Koneffkes Stärke ist die Anschaulichkeit seiner Prosa, die Bildhaftigkeit, die sich mit den Personen und Schauplätzen wie von selbst einzustellen scheint. Man erfährt, was auf den Tisch kommt und was beim Essen unterm Tisch passiert, welche Kleider getragen und welche Intrigen gesponnen werden, welche Gefühle die Charaktere umtreiben, wie es in ihren Wohnungen aussieht und in welchen Phantasmagorien sie wohnen. Es gibt Szenen voller irrwitziger Komik und voller Grausamkeit; es ist nicht das unverdrossene, augenzwinkernde Fabulieren, es fließt Blut, es gibt Verrat und Tod. Denn wenn einer sieben Leben haben soll, muss er dafür eben auch sieben Tode sterben.
Mag ja sein, dass es etwas Altmodisches hat, einfach zu erzählen, ohne sich ständig an der Unmöglichkeit des Erzählens zu reiben. Mag auch sein, dass es hilft, wenn einer so etwas wie eine Poetologie hat oder selbstreferentielle Pirouetten dreht, aber das bringt nicht wirklich weiter, wenn man nicht weiß, wie daraus zwingende Prosa wird. Bei Jan Koneffke sieht das alles ganz einfach aus. Selbstreflexion ist da nur eine Frage des geglückten Dialogs: ",Warum erfindet man eine Geschichte?', verlangte er von mir zu wissen. ,Um keine Geisel der Zeit mehr zu sein', sagte ich, wieder sicherer werdend. ,Wer Geschichten erfindet, der kann sie verlangsamen oder beschleunigen, dehnen oder stauchen. Er kann sie umkehren, anhalten, stillstellen, wenn er sich von einer Erinnerung nicht trennen will, einem Gesicht, einem Menschen. Nichts ist unwiderruflich und nichts, was sich in der Vergangenheit abspielte, notwendig. Seine Geschichte beginnt an dem fernen Punkt in der Vergangenheit, als nichts entschieden war und das Leben noch einen ganz anderen Verlauf nehmen konnte.'"
Koneffke hat, weil er sich, wie sein Held, mit der eisernen Notwendigkeit langweilt, einen Hang zum Märchenhaften, zum Phantastischen. Und indem er ihm nachgibt, wirkt die zerstückelte Biographie seines Protagonisten schon wieder normal im Vergleich zu den Geschichten, die sich dieser Felix ausdenkt, für jene Menschen, die ihm nahe sind. Wenn einer vom "goldenen Wal in den Bergen" erzählt, von einer preußischen Riesenkanone oder vom osmanischen Meisterdieb, der elf Sultane überlebte, ist es völlig glaubwürdig, dass Felix nach einem Erdbeben samt Resten seines Zimmers aus dem zehnten Stock auf der Straße steht.
Er habe beim Schreiben bisweilen an "1001 Nacht" gedacht, sagt Koneffke, vor allem wegen der balkanischen Schnittstelle zwischen Okzident und Orient, gelegentlich auch an den dauerstaunenden Simplicissimus; doch viel entscheidender ist, dass er diesen Felix, dessen Namen ein böses Omen ist, in eine Welt versetzt, die vom Geschichtenerzählen lebt - wobei Wahrheit oder Wahrscheinlichkeit dieser Geschichten weit weniger wichtig sind, als dass sie so gut erzählt sind, dass beim Lesen ein unwiderstehlicher Sog entsteht. Das erinnert von ferne an den Satz von Max Frisch: "Jeder Mensch, nicht nur der Dichter, erfindet seine Geschichten - nur dass er sie, im Gegensatz zum Dichter, für sein Leben hält." Und weil diese Geschichten auch noch ein Fenster in eine fremde, ferne Zeit aufstoßen, klappt man am Ende nicht einfach ein Buch zu, sondern taucht auf aus einer anderen Welt.
PETER KÖRTE.
Jan Koneffke: "Die sieben Leben des Felix Kannmacher". Roman. Dumont-Buchverlag, 510 Seiten, 19,99 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main