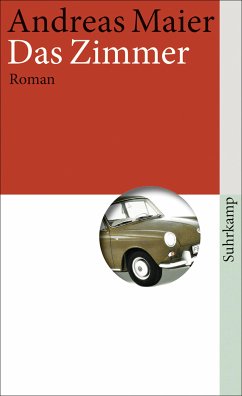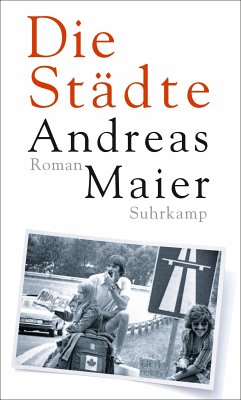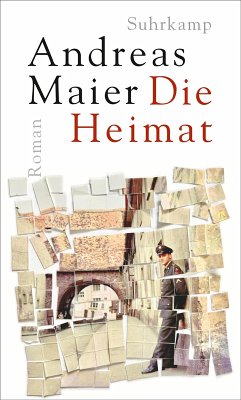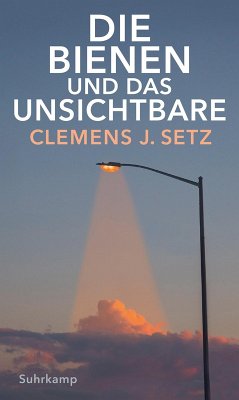Marion Poschmann
eBook, ePUB
Die Sonnenposition (eBook, ePUB)
Sofort per Download lieferbar
Statt: 11,00 €**
** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!






Der rundliche Rheinländer Altfried Janich findet nach der Wiedervereinigung eine Stelle im »Ostschloss«, einem alten Barockbau, der neuerdings eine psychiatrische Anstalt beherbergt. Hier hält er es für seine Aufgabe, seinen Patienten gegenüber die Sonnenposition einzunehmen, ihnen eine Orientierung zu geben. Als sein Freund Odilo durch einen rätselhaften Autounfall zu Tode kommt, gerät er selbst auf die Nachtseite der Dinge. Patienten rücken ihm zu nahe, Erinnerungen bedrängen ihn, seine Familiengeschichte holt ihn ein. Alle Geschichten seines Lebens scheinen hier zu enden, und bald...
Der rundliche Rheinländer Altfried Janich findet nach der Wiedervereinigung eine Stelle im »Ostschloss«, einem alten Barockbau, der neuerdings eine psychiatrische Anstalt beherbergt. Hier hält er es für seine Aufgabe, seinen Patienten gegenüber die Sonnenposition einzunehmen, ihnen eine Orientierung zu geben. Als sein Freund Odilo durch einen rätselhaften Autounfall zu Tode kommt, gerät er selbst auf die Nachtseite der Dinge. Patienten rücken ihm zu nahe, Erinnerungen bedrängen ihn, seine Familiengeschichte holt ihn ein. Alle Geschichten seines Lebens scheinen hier zu enden, und bald stellt sich die Gewissheit ein, dass er aus dem Schloss nicht mehr wegkommen wird. Ein Roman über die Macht der Zeit, über Erinnerung und zeitlose Verbundenheit. Ein Roman über fragile Identitäten, über den schönen Schein und die Suche nach dem inneren Licht - funkelnd, glasklar und von subtiler Spannung.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.
- Geräte: eReader
- ohne Kopierschutz
- eBook Hilfe
- Größe: 1.48MB
- FamilySharing(5)
- Text-to-Speech
- Alle Texte können hinsichtlich Größe, Schriftart und Farbe angepasst werden
- Keine oder unzureichende Informationen zur Barrierefreiheit
Marion Poschmann wurde in Essen geboren und lebt heute in Berlin. Für ihre Lyrik und Prosa wurde sie mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bremer Literaturpreis 2021 für ihren Lyrikband Nimbus und im selben Jahr mit dem WORTMELDUNGEN-Literaturpreis. Zuletzt erhielt sie 2023 den Joseph-Breitbach-Preis für ihr Gesamtwerk.
Produktdetails
- Verlag: Suhrkamp Verlag
- Seitenzahl: 337
- Erscheinungstermin: 21. August 2013
- Deutsch
- ISBN-13: 9783518734605
- Artikelnr.: 39204160
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Marion Poschmann ist eines der großen Talente ihrer Generation, soviel steht für Susanne Mayer fest, und mit ihrem neuen Roman "Die Sonnenposition" hat sie das erneut unter Beweis gestellt. Zwei Helden hat diese Geschichte, berichtet Mayer: Altfried, ein westdeutscher Psychiater, ist nach der Wende in den Osten gegangen, um dort zu arbeiten; Odilo ist einer seiner ehemaligen Patienten und zu Beginn des Buches bereits tödlich verunglückt; Altfried erzählt von ihrer Freundschaft, die nie wirklich eine war, von seiner Heimat Bonn, von dem Schlösschen in Ostdeutschland, in dem er als Psychiater seinen eigenen Kosmos geschaffen hat, in dem er für seine Patienten die Sonnenposition einnimmt, wie die Rezensentin schreibt: Alles kreist um ihn und er sieht alles. Poschmann wechselt zwischen dem bedrückenden "Sound der Pharmaindustrie" und ihrer eigenen bildreichen Sprache hin und her, berichtet Mayer. Aber auch die Lyrikerin gibt sich zu erkennen, verrät die Rezensentin, zum Beispiel wenn Poschmann "Wolkenfetzen von widerlicher Unentschlossenheit" beschreibt, und in diesen Momenten will Mayer das Buch gar nicht mehr zuklappen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Ein philosophisch hochintelligenter und erzählerisch virtuoser Roman ... Über die Dämonen der Aufklärung und die Schattenzonen der menschlichen Psyche ist schon Iange kein so kluges und aufwühlendes Buch mehr geschrieben worden.« Michael Braun Neue Zürcher Zeitung 20131005
Gebundenes Buch
Die Sonne bröckelt.
Der Literaturwissenschafter Edgar Allen Poe hat die These aufgestellt, der erste Satz eines Romans umreiße oft schon die ganze Geschichte. So mancher Leser von Monika Poschmanns Roman «Die Sonnenposition» mit seinem einleitenden Dreiwortsatz «Die …
Mehr
Die Sonne bröckelt.
Der Literaturwissenschafter Edgar Allen Poe hat die These aufgestellt, der erste Satz eines Romans umreiße oft schon die ganze Geschichte. So mancher Leser von Monika Poschmanns Roman «Die Sonnenposition» mit seinem einleitenden Dreiwortsatz «Die Sonne bröckelt» wird ihm möglicherweise recht geben. Das Bröckeln jedenfalls zieht sich als verfallträchtiger Hintergrund durch den ganzen Roman, die vielfach mit Literaturpreisen bedachte Autorin lenkt den Fokus in ihren bisher drei Romanen immer wieder, scheinbar deterministisch, auf die Schattenseiten unseres Lebens. Scheitern, Pessimismus, Sprachlosigkeit, Lieblosigkeit, soziale Kälte allenthalben, was sich sowohl in einer düsteren Thematik, aber noch deutlicher in der metapherträchtigen, lyrikartigen sprachlichen Umsetzung und in den eigenartigen, eher ungewöhnlichen Figuren ihrer Geschichte widerspiegelt.
Ich-Erzähler ist ein farblos bleibender Psychiater mit dem bezeichnenden Namen Altfried, der in einem heruntergekommenen Barockschloss in der ehemaligen DDR lebt und arbeitet, welches notdürftig zur psychiatrischen Heil- und Pflegeanstalt umgebaut wurde. Sein Freud Odilo, verklemmtes Muttersöhnchen und auf Biolumineszenz spezialisierter, genialer Biologe, ist äußerst menschenscheu, geradezu unnahbar und kalt. Er stirbt als schlafwandelnder Autofahrer gleich zu Beginn der Geschichte, und bei der Beerdigung taucht überraschend auch Mila auf, Altfrieds Schwester. In Rückblenden erfahren wir, dass zwischen Odilo und Mila mehr war als nur Freundschaft, was auch Altfried nicht wusste. Die Beziehungen zwischen den drei Protagonisten sind merkwürdig distanziert, man weiß wenig voneinander, sieht sich eher selten, hat sich kaum etwas zu sagen, glaubhaft portraitiert erscheinen sie mir nicht. Altfried hat die Sonnenposition inne in seiner kafkaesken Anstalt, er beleuchtet die seelische Düsternis um ihn herum, gibt sein Bestes, um zu helfen. Orientierung und Trost aber könnte er selbst brauchen, sein eigens Leben ist beklemmend eintönig und inhaltsleer, nur in seinem grotesken Hobby, seiner stets erfolglos bleibenden Jagd nach automobilen Erlkönigen, zeigt er so etwas wie menschliches Empfinden, weit entfernt jedoch von echter Leidenschaft für sein fotografisches Steckenpferd.
Erzählt ist dieser handlungsarme Roman in einer auf reichlich Metaphern, Symbolik und gewagten Wortschöpfungen basierenden Sprache, die nicht jedem gefallen dürfte, weil sie viel Phantasie voraussetzt, oft auch wohlwollende Nachsichtigkeit bei den wahrlich nicht immer gelungenen Assoziationen, die sie bewirken soll. Sie kommt ohne direkte Rede aus, ist wohltuend klar, flüssig lesbar und unkompliziert, Leser mit Hang zur Symbolik werden jubeln dabei, das Feuilleton hat mit geradezu hymnischen Rezensionen ja die Richtung vorgegeben. Wer reine Prosa mag ohne lyrische Höhenflüge, der wird zumindest in den zahlreichen, anschaulich beschriebenen Fallgeschichten von Altfrieds Patienten auf seine Kosten kommen, aber auch die Reise in die ehemalige polnische Heimat ist eine erfreulich geerdet erscheinende Prosainsel inmitten einer metaphysischen Abgehobenheit, wie sie allein schon in kreativen Kapitelüberschriften wie Glühbirnengleichnis, Rückenfiguren, Gedächtnispaläste oder Schlafversager deutlich wird.
Tristesse und Depression scheint 2013 Schwerpunktthema gewesen zu sein beim Deutschen Buchpreis. Neben der Gewinnerin Terézia Mora haben mit Mirko Bonné und Marion Poschmann gleich drei Finalisten ihren literarischen Beitrag geleistet zu den dunklen Seiten der menschlichen Existenz, nur Monika Zeiner war da ein literarischer Lichtblick für mich. «Die Sonnenposition» ist jedenfalls einer der wenigen Romane nach langer Zeit, bei dem ich froh war, ihn endlich beiseite legen zu können nach der Lektüre, vielleicht ja mein Fehler!
Weniger
Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Der 32jährige rundliche Rheinländer Altfried Janich ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Nach der Wiedervereinigung findet er eine Anstellung im Ostschloss, welches ein alter und heruntergekommener Barockbau ist, der nun als psychiatrische Anstalt dient.
Dort sieht er …
Mehr
Der 32jährige rundliche Rheinländer Altfried Janich ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Nach der Wiedervereinigung findet er eine Anstellung im Ostschloss, welches ein alter und heruntergekommener Barockbau ist, der nun als psychiatrische Anstalt dient.
Dort sieht er es als seine Aufgabe an, den Patienten Orientierung zu schenken und für sie die Sonnenposition einzunehmen. Doch nach dem rätselhaften Autounfall seines Freundes Odilo, bei dem dieser tödlich verunglückt, beginnt Altfried auf die Nachtseite der Dinge zu geraten. Er kann die Nächte über nicht schlafen, geisert durch die Gänge, denn er wohnt in dem Ostschloss. Er fühlt sich von den Patienten bedrängt und bemerkt den Zerfall des Gebäudes. Es werden auch ein paar Patienten und deren Geschichten vorgestellt, zum Beispiel die zweifache Mutter, die nun ihre Schwangerschaften verheimlicht und ihre gerade geborenen Kinder ertränkt, erfriert oder stranguliert.. Oder auch den Mann, der alles mindestens in doppelter Ausführung besitzen muss, damit er, falls das eine Produkt kaputt geht, sofortigen Ersatz hat und nicht Angst haben muss, dass sein Gerät oder Kleidungsstück nicht mehr zu haben ist.
Altfried denkt nach und nach immer mehr über seine eigene Vergangenheit nach, auch daran, wie er Odilo kennen lernte. Er erinnert sich an Odilo, den erfolgreichen Freund, der im Labor arbeitete, an Biolumineszenz forschte und versuchte, per Genmanipulation Mäuse leuchten zu lassen.
Doch was Altfried zunächst verwundert ist, dass seine Schwester Mila von dem Tod Odilos ebenfalls betroffen ist und als er von ihrer Beziehung erfährt, weiß er zunächst nicht, wie er damit umgehen soll.
Altfried wundert sich, was Odilo ihm bedeutet hat. Schließlich war dieser kein richtiger Freund, oder etwa doch? Es war schwieig, Odilo nahe zu sein.. Er war konservativ und verklemmt, er war Karrietist und Einzelkind..
Nach und nach beginnt Altfried zu verstehen, die Erinnerungen führen in das Schloss und er beginnt sich sicher zu sein, nie mehr aus dem Schloss heraus zu kommen.
Marion Poschmann, die Germanistik, Philosophie und Slawistik studierte, hat mit ihrem Roman “Die Sonnenposition” ein außergewöhnliches Werk geschaffen. Poetisch beschreibt sie Altfrieds Gefühle, sodass man sie sehr gut nachvollziehen, ja, nachfühlen kann. Die Beschreibungen des Ostschlosses und der Patienten haben mich sehr beeindruckt. Auch wie sie die verschiedenen Handlungen und Personen miteinander verwoben hat, war für mich sehr faszinierend. Auch, wie der Umgang mit den Insassen beschrieben wird, war sehr interessant für mich. Odilos Experimente mit Biolumineszenz konnten auch meine Neugierde wecken und ich bleibe beeindruckt zurück, von dieser poetischen Sprache, dieser Art sich auszudrücken und die vielschichtigen Charaktere mit Leben zu füllen.
Es hieß, dieses Buch würde von der Macht der Zeit, der Erinnerung und der zeitlosen Verbundenheit, sowie über fragile Identitäten, den schönen Schein und der Suche nach dem innreren Licht berichten. Dieses Versprechen wurde gehalten!
Ich kann dieses Buch wirklich weiterempfehlen, nur sollte man sich beim Lesen Zeit nehmen, um die Sprache, die Metaphern und Vergleiche und eingeflochtenen Theorien, zum Beispiel zu Ort und Zeit, wirklich verstehen und über sie nachdenken zu können. Denn dieses Buch regt zum Nachdenken an und lässt den Leser lange nicht los.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für