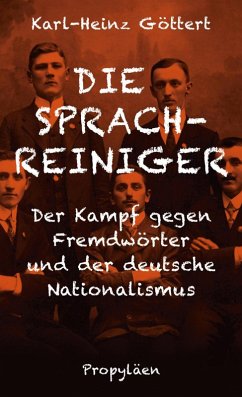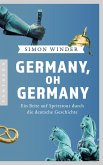Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Dienst am deutschen Wesen: Karl-Heinz Göttert zeigt, was Sprachwarte der Nation angetrieben hat - und heute wieder antreiben könnte.
Von Helmut Mayer
In einer der ersten Szenen seiner "Letzten Tagen der Menschheit" lässt Karl Kraus vier junge Männer auftreten, die, ausgerüstet mit Leiter, Papierstreifen und Klebstoff, durch die Wiener Vorstadt ziehen. Sie sind damit beschäftigt, Fremdsprachiges auf Geschäftsschildern zu überkleben: Wo das deutsch oder zumindest so ähnlich sprechende Vaterland im Kampf steht, müssen französische, englische und italienische Worteindringlinge zum Ausweis nationalen Selbstbewusstseins getilgt werden. Der Trupp ist auf Fremdwörterjagd.
Bei Kraus läuft das auf eine Posse hinaus, die über flugs vorgenommene Umbenennungen - aus "Salon Stern, Modes et Robes" wird "Salo Stern Mode", aus dem "Café Westminster" das "Westmünster" - zu einem Pastiche angestammten Fremdwortgebrauchs im Wienerischen führt, wie er noch Theodor W. Adorno in seinen "Worten aus der Fremde" faszinierte: "Es ist am besten, wir separieren uns jetzt, ihr zwei bleibts auf dem Trottoir, wir gehen fisafis." Darauf der andere: "Das ist fatal, . . . ich bin sehr pressiert, ich hab nämlich ein Rendezvous."
Was Kraus hier aufspießte, ein nationalistischer "Sprachkoller", der sich in der geforderten Tilgung beziehungsweise Eindeutschung von Fremdwörtern niederschlug, verdankte sich nicht bloß Privataktionen, die als Bekundung patriotischer Aufwallungen geduldet wurden. In Karl-Heinz Götterts neuem Buch über deutsche Kämpfe gegen Fremdwörter kann man nachlesen, dass es in Wien damals behördliche Aufrufe gab, Geschäfte mit fremdländischen Aufschriften zu melden, während in Deutschland sich gleich die Polizei daranmachen konnte, gegen "undeutsche" Ladenschilder und Produktbezeichnungen vorzugehen.
Leo Spitzer, damals noch lange nicht der berühmte Romanist und Sprachforscher, kam in einer im letzten Kriegsjahr veröffentlichten Streitschrift gegen "Fremdwörterhatz und Fremdvölkerhass" auch auf die Abhängung eines Schilds mit der Aufschrift "Café français" unter "Volksbeteiligung und Weihestimmung" zu sprechen Und ein Jahr zuvor war in der "Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins" zu lesen, dass man mit Vertretern von Handel und Gewerbe eine "Verdeutschungsliste" aufgestellt habe, "welche die Befreiung des äußeren Straßenbildes von den fremdsprachigen Geschäftsschilderaufschriften" fördern sollte.
Im Rückblick mögen sich solche Anwandlungen als Kuriositäten ausnehmen. Aber der Verfolgungsfuror, der Chauvinismus und die mit ihm verknüpften nationalen Reinheitsphantasien, welche der Kampf gegen Fremdwörter mobilisierte, waren durchaus nicht beschränkt auf die Kriegsjahre. Zwar lag dieser Kampf nationalistischen Verteufelungen des Fremden - allen voran der "Wälschen", also der Franzosen - nicht zugrunde, sondern setzte vielmehr auf bereits im neunzehnten Jahrhundert und erst recht im Kaiserreich gut eingeübte Affekte auf. Doch gerade deshalb, so Götterts einsichtige Begründung, bieten "sprachreinigende" Pamphlete und Unternehmen die Möglichkeit, ebendiesen Affekten auf einem eher harmlos scheinenden Terrain mit einer gewissen Entspanntheit nachzugehen, zu der auch die unfreiwillige Komik so mancher mitgeteilter Vorschläge zur Eindeutschung ihren Teil beiträgt.
Göttert hat zu diesem Zweck im Wesentlichen eine Geschichte des Zentralorgans des Kampfs gegen "undeutsche" Worte, des schon genannten "Allgemeinen Deutschen Sprachvereins" und seiner Zeitschrift (ab 1923 erschien sie unter dem Titel "Muttersprache") geschrieben. Von knappen Hinweisen auf die Vorgeschichte solcher "Sprachpflege" abgesehen, umfasst sie deshalb die Lebenszeit des Zeitschrift des "Sprachvereins", von 1885 bis zum Frühjahr 1943.
Den Beginn macht das Porträt eines Mannes, der eigentlich die sprachliche Weltläufigkeit selbst ist, bloß als Generalpostdirektor des eben etablierten Kaiserreichs nicht nur Vereinheitlichungen im Postdienst durchsetzt, sondern dabei auch angestammte Fremdwörter ausrangiert. Dieser Heinrich von Stephan steht für eine tatsächlich noch recht harmlose Variante des Eindeutschens. Aber schon mit dem Gründer des "Sprachvereins" betritt man das Terrain, auf dem sich ein national grundierter Reinigungsfuror samt querulantischem Einschlag durchsetzt. Getragen wird dieser Furor vor allem von Vertretern des höheren und mittleren Bildungswesens, die sich zu Sprachwarten der Nation aufschwingen.
Von der etablierten Sprachwissenschaft, die ihre Attacken gegen Fremdworte - schon bei der Definition beginnen die Probleme - abkanzelt, lassen sie sich nicht beeindrucken: Es gilt den Dienst am deutschen Wesen, das endlich zur Geltung zu bringen sei, wobei eine charakteristische Mischung aus nationalen Kränkungsphantasien - laufend ist von befleckter Ehre, Schmach oder Versündigung die Rede - und daraus resultierenden Aggressionen gegen die vermeintliche "Überflutung", "Verhunzung" oder auch "Durchseuchung" der deutschen Sprache mit undeutschen Elementen den Ton bestimmt.
Diese Mischung ist, weil das Sprachthema an die nationalistischen Diskurse andockt, zwar nicht verwunderlich. Aber erstaunlich ist doch, was die Sprachreiniger konkret so alles aufboten an Eindeutschungen, von alltäglichen Redesituationen über Schule, Recht, Handel und Bankwesen bis zu Tanz und Sport. Das beginnt bei der deutschen Speisekarte und geht fort bis zur Tilgung der englischen Bezeichnungen im Fußball. Wobei "Tor" für "Goal" gleich ein Beispiel abgibt für eine der erfolgreichen Ersetzungen, die es durchaus gab. Der Weg dorthin konnte allerdings heikel sein, etwa bei der Ersetzung von "Invalide" durch "Kriegskrüppel", dessen Direktheit es gleich wieder zuzudecken galt: Man griff auf ein Lied von Paul Gerhardt zurück und schuf den "Kriegsversehrten".
Dieses Beispiel hätte den Adepten des "Sprachvereins" eigentlich ein Licht aufstecken können, warum den Nationalsozialisten die Fremdwörter kein Stein des Anstoßes waren: zum einen ließ sich mit ihnen renommieren, zum anderen konnte man auch einiges hinter ihnen verbergen. Weshalb die 1933 mit Verve vollzogene Gleichschaltung des "Sprachvereins" mit vollmundigen Beschwörungen von Scholle, Blut und völkischem Bewusstsein nichts brachte: Weder Goebbels, dem man beherzt angetragen hatte, sich doch "Werbeminister" zu nennen, noch Hitler ließen sich erweichen, selbst wenn es erst Anfang 1943, als es mit der zwischendurch schon gehegten Hoffnung auf Deutsch als neuer Weltsprache definitiv vorbei war, auch mit der Zeitschrift vorbei war.
Muss man solche Anwandlungen, wie Göttert sie detailreich vorführt, ohne sich kritisch in sie verbeißen zu müssen, denn die bündig resümierten und zitierten Quellen sprechen für sich, heute noch einmal befürchten? Wohl kaum, selbst wenn die Sprachwarte natürlich immer bereitstehen. Aber das ist auch nicht der Punkt von Götterts lesenswerter Darstellung: Sie lässt die Affekte erkennen, die den Kampf der Sprachreiniger antrieben. Und mit denen ist immer noch und wieder zu rechnen.
Karl-Heinz Göttert: "Die Sprachreiniger". Der Kampf gegen Fremdwörter und der deutsche Nationalismus.
Propyläen Verlag, Berlin 2019.
367 S., Abb., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Dienst am deutschen Wesen: Karl-Heinz Göttert zeigt, was Sprachwarte der Nation angetrieben hat - und heute wieder antreiben könnte.
Von Helmut Mayer
In einer der ersten Szenen seiner "Letzten Tagen der Menschheit" lässt Karl Kraus vier junge Männer auftreten, die, ausgerüstet mit Leiter, Papierstreifen und Klebstoff, durch die Wiener Vorstadt ziehen. Sie sind damit beschäftigt, Fremdsprachiges auf Geschäftsschildern zu überkleben: Wo das deutsch oder zumindest so ähnlich sprechende Vaterland im Kampf steht, müssen französische, englische und italienische Worteindringlinge zum Ausweis nationalen Selbstbewusstseins getilgt werden. Der Trupp ist auf Fremdwörterjagd.
Bei Kraus läuft das auf eine Posse hinaus, die über flugs vorgenommene Umbenennungen - aus "Salon Stern, Modes et Robes" wird "Salo Stern Mode", aus dem "Café Westminster" das "Westmünster" - zu einem Pastiche angestammten Fremdwortgebrauchs im Wienerischen führt, wie er noch Theodor W. Adorno in seinen "Worten aus der Fremde" faszinierte: "Es ist am besten, wir separieren uns jetzt, ihr zwei bleibts auf dem Trottoir, wir gehen fisafis." Darauf der andere: "Das ist fatal, . . . ich bin sehr pressiert, ich hab nämlich ein Rendezvous."
Was Kraus hier aufspießte, ein nationalistischer "Sprachkoller", der sich in der geforderten Tilgung beziehungsweise Eindeutschung von Fremdwörtern niederschlug, verdankte sich nicht bloß Privataktionen, die als Bekundung patriotischer Aufwallungen geduldet wurden. In Karl-Heinz Götterts neuem Buch über deutsche Kämpfe gegen Fremdwörter kann man nachlesen, dass es in Wien damals behördliche Aufrufe gab, Geschäfte mit fremdländischen Aufschriften zu melden, während in Deutschland sich gleich die Polizei daranmachen konnte, gegen "undeutsche" Ladenschilder und Produktbezeichnungen vorzugehen.
Leo Spitzer, damals noch lange nicht der berühmte Romanist und Sprachforscher, kam in einer im letzten Kriegsjahr veröffentlichten Streitschrift gegen "Fremdwörterhatz und Fremdvölkerhass" auch auf die Abhängung eines Schilds mit der Aufschrift "Café français" unter "Volksbeteiligung und Weihestimmung" zu sprechen Und ein Jahr zuvor war in der "Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins" zu lesen, dass man mit Vertretern von Handel und Gewerbe eine "Verdeutschungsliste" aufgestellt habe, "welche die Befreiung des äußeren Straßenbildes von den fremdsprachigen Geschäftsschilderaufschriften" fördern sollte.
Im Rückblick mögen sich solche Anwandlungen als Kuriositäten ausnehmen. Aber der Verfolgungsfuror, der Chauvinismus und die mit ihm verknüpften nationalen Reinheitsphantasien, welche der Kampf gegen Fremdwörter mobilisierte, waren durchaus nicht beschränkt auf die Kriegsjahre. Zwar lag dieser Kampf nationalistischen Verteufelungen des Fremden - allen voran der "Wälschen", also der Franzosen - nicht zugrunde, sondern setzte vielmehr auf bereits im neunzehnten Jahrhundert und erst recht im Kaiserreich gut eingeübte Affekte auf. Doch gerade deshalb, so Götterts einsichtige Begründung, bieten "sprachreinigende" Pamphlete und Unternehmen die Möglichkeit, ebendiesen Affekten auf einem eher harmlos scheinenden Terrain mit einer gewissen Entspanntheit nachzugehen, zu der auch die unfreiwillige Komik so mancher mitgeteilter Vorschläge zur Eindeutschung ihren Teil beiträgt.
Göttert hat zu diesem Zweck im Wesentlichen eine Geschichte des Zentralorgans des Kampfs gegen "undeutsche" Worte, des schon genannten "Allgemeinen Deutschen Sprachvereins" und seiner Zeitschrift (ab 1923 erschien sie unter dem Titel "Muttersprache") geschrieben. Von knappen Hinweisen auf die Vorgeschichte solcher "Sprachpflege" abgesehen, umfasst sie deshalb die Lebenszeit des Zeitschrift des "Sprachvereins", von 1885 bis zum Frühjahr 1943.
Den Beginn macht das Porträt eines Mannes, der eigentlich die sprachliche Weltläufigkeit selbst ist, bloß als Generalpostdirektor des eben etablierten Kaiserreichs nicht nur Vereinheitlichungen im Postdienst durchsetzt, sondern dabei auch angestammte Fremdwörter ausrangiert. Dieser Heinrich von Stephan steht für eine tatsächlich noch recht harmlose Variante des Eindeutschens. Aber schon mit dem Gründer des "Sprachvereins" betritt man das Terrain, auf dem sich ein national grundierter Reinigungsfuror samt querulantischem Einschlag durchsetzt. Getragen wird dieser Furor vor allem von Vertretern des höheren und mittleren Bildungswesens, die sich zu Sprachwarten der Nation aufschwingen.
Von der etablierten Sprachwissenschaft, die ihre Attacken gegen Fremdworte - schon bei der Definition beginnen die Probleme - abkanzelt, lassen sie sich nicht beeindrucken: Es gilt den Dienst am deutschen Wesen, das endlich zur Geltung zu bringen sei, wobei eine charakteristische Mischung aus nationalen Kränkungsphantasien - laufend ist von befleckter Ehre, Schmach oder Versündigung die Rede - und daraus resultierenden Aggressionen gegen die vermeintliche "Überflutung", "Verhunzung" oder auch "Durchseuchung" der deutschen Sprache mit undeutschen Elementen den Ton bestimmt.
Diese Mischung ist, weil das Sprachthema an die nationalistischen Diskurse andockt, zwar nicht verwunderlich. Aber erstaunlich ist doch, was die Sprachreiniger konkret so alles aufboten an Eindeutschungen, von alltäglichen Redesituationen über Schule, Recht, Handel und Bankwesen bis zu Tanz und Sport. Das beginnt bei der deutschen Speisekarte und geht fort bis zur Tilgung der englischen Bezeichnungen im Fußball. Wobei "Tor" für "Goal" gleich ein Beispiel abgibt für eine der erfolgreichen Ersetzungen, die es durchaus gab. Der Weg dorthin konnte allerdings heikel sein, etwa bei der Ersetzung von "Invalide" durch "Kriegskrüppel", dessen Direktheit es gleich wieder zuzudecken galt: Man griff auf ein Lied von Paul Gerhardt zurück und schuf den "Kriegsversehrten".
Dieses Beispiel hätte den Adepten des "Sprachvereins" eigentlich ein Licht aufstecken können, warum den Nationalsozialisten die Fremdwörter kein Stein des Anstoßes waren: zum einen ließ sich mit ihnen renommieren, zum anderen konnte man auch einiges hinter ihnen verbergen. Weshalb die 1933 mit Verve vollzogene Gleichschaltung des "Sprachvereins" mit vollmundigen Beschwörungen von Scholle, Blut und völkischem Bewusstsein nichts brachte: Weder Goebbels, dem man beherzt angetragen hatte, sich doch "Werbeminister" zu nennen, noch Hitler ließen sich erweichen, selbst wenn es erst Anfang 1943, als es mit der zwischendurch schon gehegten Hoffnung auf Deutsch als neuer Weltsprache definitiv vorbei war, auch mit der Zeitschrift vorbei war.
Muss man solche Anwandlungen, wie Göttert sie detailreich vorführt, ohne sich kritisch in sie verbeißen zu müssen, denn die bündig resümierten und zitierten Quellen sprechen für sich, heute noch einmal befürchten? Wohl kaum, selbst wenn die Sprachwarte natürlich immer bereitstehen. Aber das ist auch nicht der Punkt von Götterts lesenswerter Darstellung: Sie lässt die Affekte erkennen, die den Kampf der Sprachreiniger antrieben. Und mit denen ist immer noch und wieder zu rechnen.
Karl-Heinz Göttert: "Die Sprachreiniger". Der Kampf gegen Fremdwörter und der deutsche Nationalismus.
Propyläen Verlag, Berlin 2019.
367 S., Abb., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main