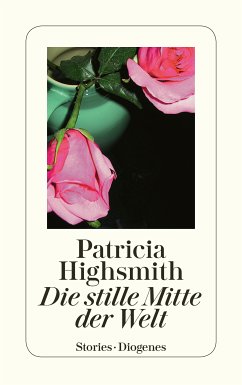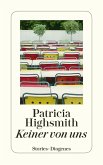Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Ihr Lebenswerk ist die Vollendung und Überbietung des Kriminalromans, ihr Lebensthema ist die Angst: Zum Auftakt der Werkausgabe von Patricia Highsmith
Es ist eine einfache Geschichte: Ein Mann kommt in eine fremde Stadt. Ausgebrochen aus einer freudlosen Existenz, steigt er kurz entschlossen dort aus dem Zug, wo ihm das einfache Leben zu Hause zu sein scheint und wo er selbst eine freundliche Bleibe findet. Wie eine Verkörperung des erhofften Glücks begegnet ihm ein phantasiebegabtes kleines Mädchen, mit dem er nun Tag für Tag selbstvergessen durch die Randzonen der neuen Heimat streift, vom Ersparten lebend, in beiderseits kindlicher Daseinsfreude. Es ist das Paradies - so lange, bis die Kleinstadtbürger des Tagediebs überdrüssig werden, bis ihm unter ihren bald nicht mehr diskreten Anfragen das Wunschbild zerbricht, bis der vermeintliche Kinderschänder den Fluchtweg einschlägt, von dem niemand zurückkehrt.
In der Welt der Patricia Highsmith ereignen sich aufregendere Tragödien als diese einfache Geschichte von 1945. Aber sie bildet doch deren Urszene. Die vergebliche Suche nach Heimat in einer Welt aus Bosheit, Mißtrauen und Verkennung, der Traum von der Unschuld, der in Gewalt und Selbstzerstörung endet: diese Verteidigung einer immer schon verlorenen Kindheit wird als Antriebskraft vorhalten für ein Lebenswerk, das am Ende zweiundzwanzig Romane und acht Erzählungsbände umfaßt.
Das Überraschendste an der Kindergeschichte ist der Umstand, daß sie bis jetzt noch nie gedruckt zu lesen war. Zusammen mit dreizehn weiteren Stories der frühen Jahre 1938 bis 1949 und drei Romanen eröffnet sie, in Highsmith' schweizerischer Wahlheimat, ihre weltweit erste Werkausgabe. Tatsächlich zum ersten Mal überhaupt werden hier die nachgelassenen Erzählungen veröffentlicht; zum ersten Mal erscheinen, in durchweg neuen Übersetzungen, alle vermeintlich vertrauten Romane und Geschichten ungekürzt; zum ersten Mal haben die Herausgeber Paul Ingendaay und Anna von Planta für die ausführlichen Nachworte ausgiebig Romanentwürfe, Briefe und Notizen aus dem Nachlaß der Autorin benutzt. Man soll das Wort von der verlegerischen Großtat sparsam verwenden - für diese Ausgabe ist es am Platz.
Die Leseerlebnisse, die Highsmith-Süchtige der Übersetzung Anne Uhdes verdanken, sollen ihr nie vergessen werden. Aber diese Neuübersetzungen sehen erheblich weiter, teils, weil sie auf ihren Schultern stehen, teils, weil sie ersichtlich ungleich konzentrierter erarbeitet sind. Erst jetzt läßt sich auch anhand der deutschen Texte begreifen, wie dicht diese Romane gewoben sind. Und Reflexionen wie die des Mörders, er habe "Gott verlassen und nicht Gott ihn", fehlten früher komplett und stehen hier deshalb in neuem, rätselhaftem Glanz. Vier der geplanten zweiunddreißig Bände sind jetzt erschienen, passend in blutrotes Leinen gebunden. Neben den frühen Geschichten in "Die stille Mitte der Welt" werden drei Muster- und Meisterbeispiele für Highsmith' Erzählkunst neu präsentiert: das Romandebüt "Zwei Fremde im Zug" von 1950, "Der Schrei der Eule" von 1962 und "Das Zittern des Fälschers" von 1969. Jeder dieser Texte entfaltet eine Variante der Urszene.
Die grausamste handelt von Bruno, dem unschuldig-bösen Helden des Erstlings. Wenn uns dieser monströs-babyhafte Dandy und Alkoholiker in seiner ganzen Egomanie doch ans Herz wächst, dann deshalb, weil auch sein Glücksverlangen das eines der Erwachsenenwelt längst abhanden gekommenen Kindes ist, weil er die freudlosen Mechanismen dieser Welt durchschaut und weil er mit mörderischer Energie auf jener Heimat beharrt, von der er nicht glauben will, daß es sie nie gab. Guy wiederum, dem braven Mann und erfolgreichen Bürger, der sich von Bruno erstaunlich willig umwerben und schließlich seinerseits zum Mord anstiften läßt, widerfährt im Nacherleben seiner Tat eine blitzartige Vision: als kleinen Jungen sieht er sich da, der von der Mutter mit einer Wärmflasche zu Bett gebracht wird.
Der tödliche Schatten
der Glücklichen
Auch Robert schließlich, der sanfte Held in "Der Schrei der Eule", will eigentlich nur als stiller Zeuge ein bißchen teilhaben am Glück, wenn er nachts heimlich einer jungen Frau in der Küche bei den alltäglichen Verrichtungen zusieht, nur weil sie so selbstverständlich zu Hause zu sein scheint in ihrer nicht gedeuteten Welt. Kindlich im Wortsinn sind auch seine Tagträume; und wenn ihn unverhofft die Liebe belohnt, die er nicht einmal gewollt hat, dann scheint das Buch gleich nach der Einführung schon am Happy-End angekommen. Was aber Robert selbst leider nicht wissen kann, das ist den Lesern bald unübersehbar: daß sich dieser einsame Mann schon längst in der Position befindet, die im früheren Roman der Säufer Bruno eingenommen hatte, der eigentlich auch nur dazugehören wollte zu den Glücklichen und dabei zu ihrem tödlichen Schatten wurde. Ganz beiläufig läßt seine Autorin ihn einmal bemerken, Jennys Anblick habe auf ihn "dieselbe Wirkung wie Schnaps auf Alkoholiker". Da ist sie wieder, Highsmith' Urszene: Je gieriger die Glückssucher ihrer Wirklichkeit in die Regression zu entkommen suchen, desto grausamer werden sie von ihr eingeholt. Ihre Hölle, das sind die Rechtschaffenen.
Der verläßlichste Trost in dieser Welt beschränkt sich auf die Erkenntnis, daß auch die umworbenen Glücklichen selbst immer nur so glücklich aussahen. Der weniger verläßliche liegt in den gleichsam windstillen Augenblicken, in denen manche ihrer Helden einem zweiten Einzelgänger und Außenseiter begegnen - in einer Liebe, die von der Kindergeschichte bis zum fliehenden Robert "nicht so ist, wie Menschen sich normalerweise lieben", und deren Schimmer noch während ihrer Zerstörung durch die kleinbürgerliche Konvention nie ganz erlöschen wird.
Es liegt nahe, diese Grundkonstellationen auch als autobiographische Reflexe zu lesen. In Paul Ingendaays klugem Nachwort zu "Zwei Fremde im Zug" findet sich Highsmith' Notiz von 1948, wonach "sex life motivates & controls all". Viele Details in diesen Texten sind kaum verständlich ohne diese Motivation durch die camouflierende Umgehung des Tabus. Dazu gehören Anspielungen aus dem homosexuellen Codebook; dazu gehört auch, daß Bruno seinem Angebeteten als Teil der Mordausrüstung nicht einfach Handschuhe schenkt, sondern ausdrücklich und ohne weitere Begründung "Damenhandschuhe, sind aber dehnbar" - so dehnbar wie die Geschlechtsidentitäten vieler Männer und Frauen in Highsmith' Welt. Dazu gehören schließlich Ausdrucksnuancen, die oft erst in der Neuübersetzung wahrnehmbar werden. Guy hat sein Buch in Brunos Zugabteil liegenlassen: "Die Vorstellung, daß das Buch die Nacht in Brunos Abteil verbrachte, daß Bruno es öffnen und berühren konnte, paßte ihm gar nicht." Es ist übrigens ein Platon-Band, der da so gewaltsam berührt und geöffnet werden wird, daß von Idealismus und Vernunft so wenig übrig bleibt wie, unter anderem, von Bruno selbst. Vielleicht gehört zum biographischen Horizont dieser frühen Bücher auch der Umstand, daß der Sex immer wieder als zerstörerische Macht erscheint, das ersehnte Glück hingegen geschwisterlich und keusch.
So evident aber dieser autobiographische Grundzug sich ausnimmt, sowenig läßt sich das Werk doch auf ihn reduzieren. Was sich hier aus dem Spiel der Doppeldeutigkeiten entwickelt, ist eine sehr viel weiter ausgreifende Analyse der Moderne, die sich von denjenigen Virginia Woolfs oder André Gides zwar gewiß in der Genrewahl, ebenso gewiß aber nicht in der Ranghöhe unterscheidet. Highsmith' Lebenswerk ist die Vollendung und Überbietung des Kriminalromans.
Die Regeln des Genres spielt die Autorin gegen sich selbst aus, indem sie sie offenlegt. Derart ausdauernd wird der Leser durch immer neue Deutungsmöglichkeiten verführt, daß er endlich auch seinen eigenen Augen nicht mehr traut - bis zur Unlesbarkeit der Welt in "Das Zittern des Fälschers", wo alles möglich scheint und nichts mehr gewiß ist. In virtuoser Spannungsregie spielen diese Experimentalromane mit der Verwandtschaft von Verbrechensplanung und Romanerfindung, von Komplott und Plot. So entwickelt Bruno seine Idee zweier scheinbar unmotivierter Morde über Kreuz, als ginge es um den Einfall zu einer Kriminalgeschichte - in genauer Umkehrung der tatsächlichen Entstehung des Romans, in dem er auftritt. Der arme Robert muß im "Schrei der Eule" für einen Mord büßen, der nie stattgefunden, den er sich aber momentlang ausgemalt hat. Der seinem Modell folgende "Geschichtenerzähler" wird dann, im gleichnamigen Roman von 1965, bloß den aufgerollten Teppich zu früher Morgenstunde vergraben und sich dabei, halb aus Rachsucht, halb um seines entstehenden Buches willen, nur der Vorstellung hingeben, er habe seine erschlagene Ehefrau darin versteckt. Wie kann er ahnen, daß er dabei heimlich beobachtet wird und daß die Frau von einem Ausflug einfach nicht zurückkehrt?
Fortwährend verschwimmen die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Wahn, und im Schlingern der Signifikanten gibt es nirgends einen verläßlichen Halt. Immerfort müssen die Protagonisten das Verhalten aller anderen deuten, ohne doch jemals Gewißheit erlangen zu können. Von den anderen hängt ihr Leben ab; sie müssen nur auf die kleinen Signale achten und richtig reagieren, sonst wird das Tor geschlossen, das doch nur für sie bestimmt war. Aber woher sollen sie wissen, worin überhaupt das Signal bestand? Wie die Helden Kafkas, so erleben auch die der Patricia Highsmith diese Unsicherheit als ihre eigene Schande, und auch sie sterben, als solle diese Scham sie überleben.
Nicht nur die Umgebung der Helden aber folgt einer undurchschaubaren Logik, auch ihre eigenen Handlungen und Reaktionen tun das. Der heimliche Held aller Highsmith-Romane ist das unberechenbare Ich. Es kann lautlos zerfallen wie in "Ediths Tagebuch", es kann sich mit dem eines anderen verwechseln wie beim talentierten Mr. Ripley und seinen Opfern, und es kann zum Doppelgänger des Feindes werden wie bei den Gegenspielern Bruno und Guy. Wenn Bruno einmal vom notwendigen Gegenstück jedes Menschen schwadroniert, dann klingt das platonische Gleichnis von der Zwei-Einheit des androgynen Urwesens wieder an. Nur daß jetzt aus den Liebesvereinigungen die Morde geworden sind, aus den Küssen die Bisse: "Irgendwo auf der Welt liegt er im Hinterhalt und wartet auf Sie." Wer aber nicht weiß, wer er ist und wo genau die eigenen Persönlichkeitsgrenzen verlaufen, der muß lernen, sich zu verkleiden, andere Identitäten anzunehmen. Und er muß, wenn es sich nicht vermeiden läßt, leider auch deren ursprüngliche Träger zum Verschwinden bringen.
Wie Traum und Wahn zur Wirklichkeit werden können, so kann sich die Wirklichkeit verflüchtigen in den Wahn und die Träume. Die Rückseite der elementaren Verstörung ist eine unerhörte Ermächtigung der Phantasie. Wer die Fiktionen richtig zu arrangieren verstünde, hätte die Welt im Griff. Das jedenfalls ist die immer neue Hoffnung der Helden. Daß sie so oft enttäuscht wird, liegt nur zum Teil an der chaotischen Unvorhersagbarkeit der Reaktionsabläufe. Es hat auch mit der falschen Vorannahme zu tun, sie hätten sich selber im Griff.
Erstaunlicherweise verselbständigen sich solche Kippfiguren nur selten zu dem amoralischen Glasperlenspiel, als das die Autorin sie gern ausgegeben hat. Denn auch die Fiktion ist nie unschuldig. Wie beim entfernt verwandten Oscar Wilde wird auch hinter Highsmith' Bemühen, ihren Unheilsgeschichten eine ästhetizistische Tönung zu geben ("wie schön der Schrei war", denkt der Mörder im Augenblick der Tat), die traurige Moralistin bemerkbar, die es mit der Bergpredigt eigenwillig genau nimmt. So wie schon derjenige mordet, der seinen Bruder heimlich verflucht, und derjenige den Ehebruch begangen hat, der eine andere Frau begehrlich ansieht: so fühlen sich ihre Helden schuldig an Morden, die sie nur in Gedanken begangen haben - und entsprechend unschuldig an anderen, die sie bloß unvermeidlich oder ungewollt begehen.
Die Fiktion als das einzige, aber leider auch lebensgefährliche Überlebensmittel: diese Idee, nicht die Geschlechterfrage, ist die vielleicht stärkste autobiographische Signatur dieser Geschichten. Zugleich wird hier ihr genuin moderner Grundzug sichtbar. Denn anders als die meisten ihrer modernistischen Weggefährten, als Capote, Hildesheimer oder Jane Bowles etwa, schreibt Highsmith nicht gegen die erzählerischen Konventionen des realistischen Mainstream an, sondern nützt im Gegenteil deren Schwungkraft aus. Das gilt vor allem für das beunruhigende Hin- und Hergleiten zwischen Erzähler- und Figurenperspektiven. Ohne Kommentare, im kühlen, eleganten Gleichmaß ihres Stils, läßt sie nur die Stimmen, Gedanken, Taten ihrer Figuren so übergenau sehen und hören, daß dem Leser Hören und Sehen vergeht.
Die Wahrheit beginnt,
wo die Körper enden
Diese Erzählerin beobachtet ihre Figuren wie eine Biologin ihre Ratten; buchstäblich ist einmal beiläufig von den "leisen, rattenartigen Geräuschen menschlicher Aktivität" die Rede. "Nachts", läßt sie ihren Guy sinnieren, "war die Zeit für das Tier im Menschen, die Zeit, wo man sich am ähnlichsten war." Diese Autorin, die einleuchtenderweise Soziologie und Zoologie studiert hat, wird im "Geschichtenerzähler" notieren: "Es vereinfachte die Dinge sehr, wenn man das alles Verhalten nannte anstatt Überzeugung, Wahrheit oder Glauben." Genau so erzählt Highsmith ihre Geschichten. Deshalb entgeht ihr kein kulturelles Accessoire ihrer Helden, kein Parfum, kein Krawattenstoff, kein Detail einer Wohnungseinrichtung. Deshalb werden Körperzustände so unheimlich minutiös registriert, von der Entstellung der Welt in den Augen des Trinkers bis zum leisesten Zittern des Fälschers.
Die Wahrheit beginnt hier erst, wo die Körper enden. Guy und Bruno ringen miteinander, "als wäre ihr Gegner der Tod". Denselben Gegner hat Robert schon oft im Traum gesehen: "Er hat glatte schwarze Haare, ein bißchen grau an den Schläfen. Auf der einen Seite einen Zahn mit Goldfüllung. Und eine Brille mit schwarzem Gestell." Der Tod sieht aus wie der Mann von nebenan. Auf die Frage, warum jemand sich umbringe, antwortet der Schriftsteller im "Zittern des Fälschers": "Vielleicht gibt es gar keinen wirklichen Grund - außer so etwas wie allgemeine Angst." Es ist diese Angst, auf die der mit Patricia Highsmith befreundete W. H. Auden das Zeitalter getauft hat. Es ist eine Kinderangst, die lebenslang nicht endet. Es ist das Lebensthema dieser epochalen Schriftstellerin.
Patricia Highsmith: "Die stille Mitte der Welt". Stories. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Melanie Walz. 400 Seiten, gebunden.
Patricia Highsmith: "Zwei Fremde im Zug". Roman. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Melanie Walz. 400 Seiten, gebunden.
Patricia Highsmith: "Das Zittern des Fälschers". Roman. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Dirk van Gunsteren. 384 Seiten, gebunden.
Patricia Highsmith: "Der Schrei der Eule". Roman. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Irene Rumler. 432 Seiten, gebunden.
Jeder Band mit einem Nachwort von Paul Ingendaay. Die Werkausgabe von Patricia Highsmith erscheint im Diogenes Verlag, Zürich. Jeder Band kostet 21,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH