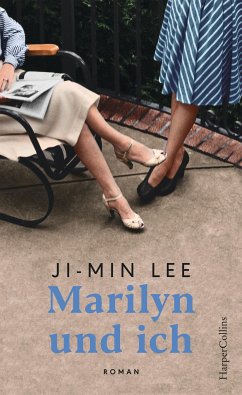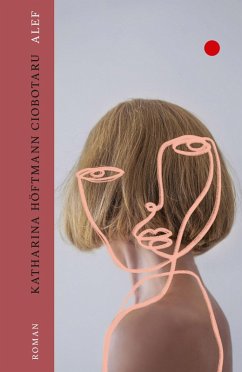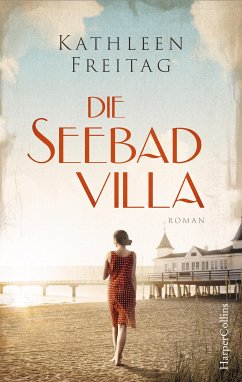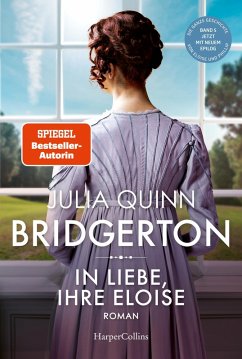Die Stimme meiner Mutter (eBook, ePUB)
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 22,00 €**
16,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
»Und Triumphe waren - das hatte sie in ihrem Leben gelernt - ein guter Ersatz für die Liebe.« 1959 hat die Karriere von Maria Callas ihren Zenit längst überschritten, als sie in Monte Carlo an Bord der Christina geht, der legendären Luxusyacht des griechischen Milliardärs Aristoteles Onassis. Drei Wochen dauert die Kreuzfahrt über die Ägäis bis nach Istanbul, und danach ist nichts wie zuvor. Maria Callas, die amerikanisch-griechische Opernsängerin, die sich aus eigener Kraft ganz an die Spitze gearbeitet hat, findet in Onassis zum ersten Mal einen Mann, dem sie ihre verletzliche Sei...
»Und Triumphe waren - das hatte sie in ihrem Leben gelernt - ein guter Ersatz für die Liebe.« 1959 hat die Karriere von Maria Callas ihren Zenit längst überschritten, als sie in Monte Carlo an Bord der Christina geht, der legendären Luxusyacht des griechischen Milliardärs Aristoteles Onassis. Drei Wochen dauert die Kreuzfahrt über die Ägäis bis nach Istanbul, und danach ist nichts wie zuvor. Maria Callas, die amerikanisch-griechische Opernsängerin, die sich aus eigener Kraft ganz an die Spitze gearbeitet hat, findet in Onassis zum ersten Mal einen Mann, dem sie ihre verletzliche Seite zeigen kann. Ungeachtet ihrer Ehepartner, die ebenfalls an Bord sind, werden sie ein Paar - ein Skandal, auf den sich die Presse sofort stürzt. Ein Roman, der dem Menschen hinter der Maske der Maria Callas zum ersten Mal gerecht wird, denn der Erzähler, ihr ungeborener Sohn Omero, kennt sie wie kein anderer.
»Kurzweilig und mit ironisch liebevollem Blick auf ihre Protagonisten.« Berliner Morgenpost, 08.08.2021 »Dieses Buch ist ein Lesegenuss, weil es brillant geschrieben ist und betörende Bilder schafft.« BR Klassik, 24.08.2021
»Das Buch insgesamt ist so stark.« »Ein literarischer Resonanz-Roman für diese besondere Stimme.« NDR Kultur, 27.08.2021
»Kurzweilig und mit ironisch liebevollem Blick auf ihre Protagonisten.« Berliner Morgenpost, 08.08.2021 »Dieses Buch ist ein Lesegenuss, weil es brillant geschrieben ist und betörende Bilder schafft.« BR Klassik, 24.08.2021
»Das Buch insgesamt ist so stark.« »Ein literarischer Resonanz-Roman für diese besondere Stimme.« NDR Kultur, 27.08.2021
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.