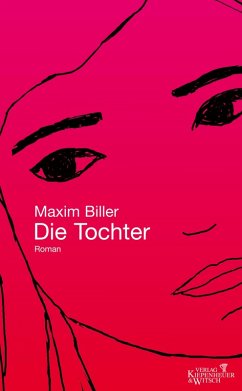Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Wo Hass und Liebe eins sind: Maxim Biller hat einen großen Roman über die gegenwärtige Vergangenheit geschrieben / Von Thomas Wirtz
Vierhundertsechsundzwanzig Seiten kann kein Polemiker. Mit nur einem Lungenflügelschlag erschöpft er sich lieber über die Kurzdistanz der Tirade, spurtet er dem Gegner leidenschaftlich in die offenen Arme oder dribbelt atemraubend auf der Stelle. Die Kondition des Polemikers bevorzugt das Spiel aus dem Erregungsstand, den trockenen Blattschuss auf engem Zeilenraum, die Blutgrätsche mit Erholungspause. Auf die lange Strecke würde ihn auch das langsamere Argument überholen.
Als Maxim Biller für die spurtbewegte Zeitschrift "Tempo" schrieb, hieß seine Kolumne "100 Zeilen Haß". Dies ist das Längenmaß des Polemikers, der eben kein Spielfeld von epischer Breite durchlaufen will. Auch Billers Erzählungsbände wählten die kleine Form, mikroskopierten den Aberwitz oder falteten die Jahrzehnte eines ganzen Lebens auf die Handlichkeit eines Steckbriefs zusammen: Die Einsamkeit des Langstreckenläufers war daraus nicht zu erfahren. Und nun vierhundertsechsundzwanzig Seiten. Auf dem Deckblatt prangt unter dem Titel "Die Tochter" die Gattungsbezeichnung "Roman" in einer kaum kleineren Schrift, als sei sie das eigentliche, das unübersehbare Ereignis: der ehemals begriffsschlaksige Hässling nun im Breitwandformat. Maxim Biller ist aus der zeilenerregten Polemik in die große, weite Literatur gesprungen - und mit beiden Beiden sicher gelandet. Sein Roman "Die Tochter" verleugnet die alte Besessenheit nicht, die Lust am Veitstanz im Minengelände der deutsch-jüdischen Geschichte, doch bändigt er den Bewegungsdrang mit strenger Disziplin. Wenn bei diesem Buch noch jemandem der Atem stockt, dann ist es der Leser.
"Als Motti Wind nach zehn langen, bedrückenden Jahren seine Tochter Nurit wiedersah, hatte sie fast gar nichts an." So lautet der erste Satz, und mit ihm endet die Entblößung noch nicht. Denn der Eingang nimmt für die Tochter vorweg, was dem Vater ein ganzes Buch hindurch abverlangt wird: die pornografische Erniedrigung, die ihm das Seelenkostüm bis zum letzten Fetzen zerreißt. Seine Geschichte ist die des einen handlungsarmen Tages in München, der durchsetzt ist von Rückblenden: der Jugend in Tel Aviv, der Teilnahme am Libanon-Krieg, der Emigration nach Deutschland, wo Motti heiratet, Vater wird, von der Familie sich trennen muss, zehn Jahre allein bleibt. Und seitdem die Sonntage mit der Videothek teilt.
Lange hat Motti den Videoangriff auf die männliche Netzhaut hinausgezögert. Er kleidet das Mädchen, das sich vor ihm auf dem Schirm auszog, mit einer Biografie ein: Erstaunt ist er über die gepflegte Erscheinung der Körperakrobatin, was er ihrer gutbürgerlichen Vergangenheit zuschreibt. Sorgende Eltern denkt er sich, die das junge Mädchen mit einer Daunendecke gegen die Nachtluft schützten, Abende im Konzertsaal, Tage in der Bibliothek. Was auf dem Schirm flimmerte, wird von diesem inneren Bildungsfilm überblendet. Das Stöhnen verschwindet im Hintergrundrauschen, vor dem die ausgedachte Idylle ihre unerregten Akzente setzt.
Biller hat an den Anfang seines Buches dessen Leitthema gesetzt: die wüste Dissonanz von Wahrnehmung und Gedanke, die Mauerschau auf der Kopfbühne. Was unmittelbar angeschaut werden muss, taucht unter im Fluss der rauschenden Assoziationen, dessen Strömung reißender ist als jeder bilderflutende Moment. Aus dem Widerspruch zwischen gefilmtem Sex und gedachter Sorge ersteht der väterliche Liebesroman. Mottis Anhänglichkeit hat die zehnjährige Trennung überdauert und damit den Beweis ihrer Unbedingtheit angetreten. Die Abwesenheit der Tochter, so will es der alte Topos der Fernliebe, ist Bedingung des fortdauernden Gefühls. Als Sehnsucht nach dem Untergetauchten, Verschwundenen hat es seinem Leben einen blinden Fleck gegeben. Lieben musste seitdem immer nur der Kopf. Heute sollen auch die Füße nach der Tochter suchen.
Doch der Kopf ist in diesem Roman nur eine wild gewordene Maschine, eine betriebsame Fehlfunktion. Motti ist Herr und Knecht dieser Kopflosigkeit des Denkens, seine Gedankenarbeit eine Zwangshandlung, die den Regelverstoß auf Dauer setzt, alles - israelische Heimat, der Krieg, die Ehe, das Kind - nur ein Eintopf von Lebensdichtung und Faktenwahrheit. Der traurige Held geht in die selbst gebaute Falle - und mit ihm der Leser, der Mottis Behauptungen Vertrauen vorschießt. Den Figuren anfänglich zu glauben ist Bedingung jeder Lektüre, und Billers Plan sieht vor, diese Gemeinsamkeit bis zur vollkommenen Zerstörung aufzukündigen, um neue Abhängigkeit darauf zu bauen. Motti ist der Köder, mit dem er Leser angeln geht.
Denn Mottis entsetztes Glück, seine Tochter Nurit gänzlich bloßgestellt wiederzusehen, macht Biller zum Albtraum des Lesers. In dem Moment, als der Vater im gefilmten Angesicht der Tochter masturbiert, wird der Leser zu seinem Komplizen. Von nun an darf er nicht mehr hoffen, in einem solchen Helden einen Verbündeten auf verschlungenen Romanwegen zu haben. Mottis Höhepunkt ist des Lesers Absturz, ihre Gemeinschaft fortan so beglückend wie die Nähe von Galeerensklaven auf der Ruderbank.
Zur klassischen Moderne hat es die Literatur am Anfang des letzten Jahrhunderts nicht zuletzt durch ihre strenge Architektur gebracht. Ihre Experimente galten damals den Baugesetzen, die der zerfallenen Welt einen zeilengenauen Masterplan entgegenstellten. Im ruinierten Haus des Seins spielte die Literatur den formvollendeten Türhüter. Dieser Versuch, die Unordnung mit Genauigkeit wieder zu überbauen, teilte die Literatur mit Freuds Psychoanalyse. Deren archäologische Metapher, das schichtenweise Freilegen einer Urgeschichte durch feinmotorische Traumarbeit, entstammt dem gleichen Geist: Überwinden der Anarchie durch ihre benennende Wiederholung.
Maxim Biller - und das ist sicher die überraschendste Erkenntnis nach seinem ersten Roman - ist ein bis in die kratzende Wolle hinein eingefärbter Traditionalist, ein Freud-Joyce-Musil-Leser. Seinen einsamen Helden - schon er eine Verbeugung vor der alten großen Zeit - lässt er in die Keller der Erinnerung hinabsteigen und bricht zugleich alle Treppen hinter ihm ab. Unrettbar verliert Motti sich in diesem dunklen Labyrinth, weil die Grubenlampe des Denkens blind geworden ist. Wie Freud erträumt er sich im Erinnern die Rettung, wie Leopold Bloom findet er in einem einzigen Tagestaumel durch München sein ganzes Leben, wie Ulrich macht er Gott und den Inzest zu seinen Weggefährten. Dieser Traditionalismus, dem sich Biller verschreibt, ersetzt Neuerungssucht durch Komplexität. Den Stammvätern des Romans treu ergeben, ist "Die Tochter" von gleicher staunenswerter Anhänglichkeit an die eine formgewordene Idee, an die Literatur als Monumentalarchitektonik. Ihr Wagemut ist, in der Polemik gegen den gut gelaunten Betrieb der Gegenwart auf den beschwerlicheren Gesetzen des Handwerks zu bestehen.
Mottis Gang in den Keller folgt dem analytischen Verfahren. Die Vergangenheit, dauernd präsent an diesem Tag, ist ein verzweigtes, nur langsam zu durchlaufendes Gebäude. Im Jahr 1982 floh er vor einer eigenhändigen Gräueltat im Libanon-Krieg ausgerechnet nach Deutschland. Dort, so sagt ihm die Erinnerung, lebte er im "Totenland" mit Sophie, die seinetwillen zum Judentum konvertierte. Seine Liebe aber dankte diese blonde Frau mit Apathie und Selbstmorddrohungen, die sich bei der Geburt ihrer Tochter verschärften. Nurit machte der Vater zu seiner symbiotischen Komplizin im Kampf gegen die deutsche Mutter, eine "kleine, stumme Königin", die er in seiner Obhut verschloss. Deutschland bleibt für ihn das Land der Richter, der Henker und zugleich der entfernteste Ort vom Selbstbehauptungswillen des todbringenden, aggressiven Israel. Vor dessen Kriegen gegen die Palästinenser ist er zum historischen Feind übergelaufen, mit dem er nichts als Auschwitz-Erzählungen teilt.
Was an dem einen Tag mit Motti geschieht, ist ein Stationendrama von biblisch-psychoanalytischen Ausmaßen. Je tiefer der Archäologe seiner selbst in den Erinnerungen schürft, desto ungeheuerlicher sind die Funde und desto unumkehrbarer ist sein Verfall. Gesammelt werden Symptome einer Krankengeschichte aus dem Geiste Pschyrembels: Der Tag ist nur mit Psychopharmaka zu überstehen, die Wahrnehmung zerfällt in Vexierspiele, Halluzinationen sind der Alltag der Kranken. Am tiefsten verschlossenen Punkt wütet der jahrelange Inzest mit seiner Tochter. Die Länge des Romans ist Mittel einer für den Leser schmerzhaften Strategie. Nur allmählich schreitet die Verfallsanalyse voran, nur stockend werden Heilslügen zertrümmert, mit denen der Kranke das unerträgliche Geheimnis zum eigenen Schutz ummauert hat. Als erst nach dreihundert Seiten aus den kleinen Andeutungen die eine große Tatsache zu werden scheint, ist der Leser mitgefangen. Er kann sich der Zumutung des Inzests nicht entziehen, weil seine Neugier ihn über die erste Buchzeile hinweggestoßen hat. Die Länge des Romans ist so Bedingung einer Komplizenschaft mit dem Leser. Als Seelenvoyeur hat er das Abwenden versäumt. In seinem Kopf ist nun eingeschlossen, was den zerstörten Helden in die Emigration der Verdrängungen getrieben hat. Er teilt mit ihm eine Geschichte, die ihm nur die unterlassene Lektüreleistung des ersten Satzes erspart hätte.
Diese peinigende Anteilnahme, die Verwandlung des Beobachters in den Mitwisser, wiederholt eine andere, wichtigere Dialektik. Denn Biller hat das Inzest-Motiv nicht wegen seines Erregungswerts gewählt. Was ihn interessiert, ist der Umschlag des schändenden Täters in das Opfer: Das Vergehen an der Tochter ist im selben Moment schon Beginn der Strafe, der Verfall faltet nur in die Zeit aus, was mit der einen Tat begann. Mottis Bedürfnis, die Tochter vor der vermeintlichen Kälte seiner Frau in Schutz zu nehmen und einen Kordon an Zuwendung um sie zu legen, schließt einen Teufelskreis. Mit der Flucht nach Deutschland, die Israel und dessen kollektive Schuld im Libanon vergessen wollte, hoffte Motti aus der öffentlichen, auferlegten Geschichte herauszutreten. Stattdessen aber hat er sie nun in die private Biografie hineinverlängert. In seinen Tagträumen muss er das Morden wiederholen, die Ermordeten immer wieder begraben.
Biller hat sein Thema weiter ausgeschrieben. "Die Tochter" ist ein Roman über die jüdische Vergangenheit, die Übertragung historischer Schuld an die Opfer, die Vergewaltigung einer ganzen Generation durch ihre Erzeuger; und er ist ein Exempel ohne Zwang, eine Parabel ohne Lehre. Denn mit einem genuin erzählerischen Verfahren wendet Biller den Vorwurf ab, lediglich die pathologische Beschädigung eines Vereinzelten vorgeführt zu haben.
Über wenige Nebensätze hat Biller die Auftritte eines Ich-Erzählers verstreut, der Mottis Stationenweg durch München wie zufällig kreuzt. Erst am Ende erfährt man die namenlose Identität dieses Ich, eines jüdischen Schriftstellers. Er hat - so erfahren wir aus einer zweiten, wieder verschachtelten Analyse - sein eigenes Leben diesem Motti an den Hals geschrieben, indem er aus den wenigen ihm bekannten Tatsachen eine unhaltbare Inzest-Geschichte erfand. Das ganze Leben eine Lüge, eine Projektion. Sein eigenes privates Scheitern - die Unfähigkeit, das Totenland zu verlassen, die Trennung von seiner zum Judentum konvertierten Frau - hat er zu einem Szenario gesteigert, mit dem er stellvertretend seinen Bekannten Motti belastet. Diesen macht er zum Sündenbock für die unmögliche Assimilation, zum Lastesel des eigenen Versagens. "Auf einmal kam ich mir vor wie Motti": Das projizierte Elend schlägt so auf seinen Urheber zurück.
Maxim Billers Roman ist ein hochambitioniertes Unternehmen, das seinen Kunstwillen meist verbergen kann. Die analytische Technik, der Selbstverrat eines Verratenen, baut eine Subtilität in die große Form auf, die über Unebenheiten im Detail hinwegträgt. So unauffällig wird Wirklichkeit widerrufen, so virtuos Liebe als Kehrseite des Selbsthasses vorgeführt, dass der Leser in seiner Aufmerksamkeit nicht nachlassen darf. Solcher Ernst ist schwer erträglich, und er ist ein Glück. Seine Entdeckung sollte man nicht anderen überlassen.
Maxim Biller: "Die Tochter". Roman. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2000. 426 S., geb., 45,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH