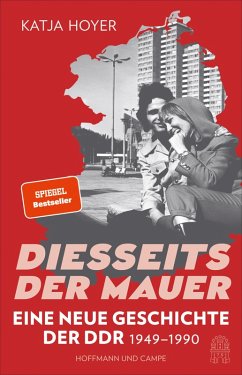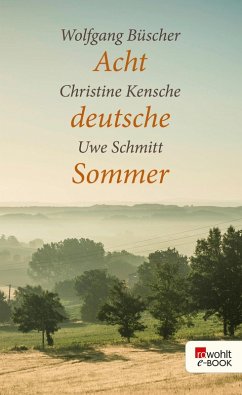Die Treuhand (eBook, ePUB)
Innensichten einer Behörde. Interviews Urheber
Redaktion: Jacobs, Olaf; Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 28,00 €**
21,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die Treuhandanstalt steht für viele Menschen für all das, was bei der Wiedervereinigung Deutschlands schiefgelaufen ist. Vor allem in Ostdeutschland ist sie zum Synonym geworden für Ausverkauf, Raubzug und Willkür, also vieles, was bis heute mit den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung verbunden ist. In diesem Buch berichten 17 Akteurinnen und Akteure aus dem Inneren der nach wie vor umstrittenen Behörde. Vorstände, Referentinnen oder Abteilungsleiter erzählen von langen Arbeitstagen, schwierigen Rahmenbedingungen und großem öffentlichem Druck. Sie erinnern sich an die ersten Arbe...
Die Treuhandanstalt steht für viele Menschen für all das, was bei der Wiedervereinigung Deutschlands schiefgelaufen ist. Vor allem in Ostdeutschland ist sie zum Synonym geworden für Ausverkauf, Raubzug und Willkür, also vieles, was bis heute mit den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung verbunden ist. In diesem Buch berichten 17 Akteurinnen und Akteure aus dem Inneren der nach wie vor umstrittenen Behörde. Vorstände, Referentinnen oder Abteilungsleiter erzählen von langen Arbeitstagen, schwierigen Rahmenbedingungen und großem öffentlichem Druck. Sie erinnern sich an die ersten Arbeitstage, an die enge Zusammenarbeit im Kollegium und an überraschende Details zu bekannten Privatisierungsfällen in Ostdeutschland. Es kommen mehrere Vorstandsmitglieder zu Wort, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Personalbereich, der Öffentlichkeitsarbeit, der Rechtsabteilung oder den regionalen Niederlassungen. Die Erinnerungen an die Arbeit innerhalb der Treuhand fügen insofern der Debatte um ihr Wirken eine weitere wichtige Perspektive - nämlich die von innen - hinzu.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.