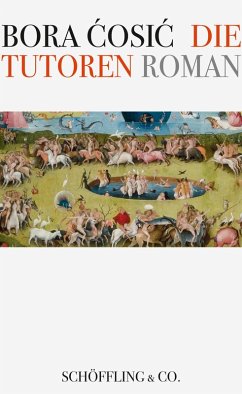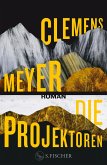Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Bora Cosic hat mit der parodistischen Familiensaga "Die Tutoren" einen Höhepunkt europäischer Sprachartistik erreicht. Nun erscheint der Roman, der lange als unübersetzbar galt, zum ersten Mal auf Deutsch.
Alle Familien leben so ähnlich, aber unsere, die hat bei Gott alles erlebt." Atemlos quasselt Frau Danica in einer Belgrader Buchhandlung nach dem Krieg auf den Buchhändler ein, und ihre Halbbildung, die sich nicht auf den verdrehten Anfangssatz aus Tolstois "Anna Karenina" beschränkt, entfaltet dabei ihre komödiantische Wirkung: die Leiden der jungen Wörter, éducation seximentale, Porträt des Künstlers als junger Hund - Hust, Proust und Pust! Es sind Sätze, an denen man sich kaum sattlesen kann, wild-skurrile Wortkaskaden aus einem Rabelaisschen Narrenspiel der Sprache, das zugleich eine Familiensaga über hundertfünfzig Jahre europäischer Geschichte darstellt.
Sie entstammt der Feder von Bora Cosic, dem Doyen der modernen serbischen Literatur, geboren 1932 in Zagreb und heute abwechselnd in Berlin und im kroatischen Rovinij zu Hause. Man kennt ihn als messerscharfen Satiriker und klugen Essayisten. Sein jetzt auf Deutsch erschienenes Opus magnum "Die Tutoren" entstand bereits in den siebziger Jahren, in einer Zeit, als die Tito-Diktatur den unangepassten Schriftsteller in die innere Emigration getrieben hatte. 1978 in Belgrad erschienen, galt dieses Meisterwerk der literarischen Avantgarde lange Zeit als unübersetzbar. Der Schöffling-Verlag und die Übersetzerin Brigitte Döbert haben sich schließlich an diesen Achttausender der Sprachgewalten gewagt. Herausgekommen ist ein fulminanter deutscher Text mit hintersinnigem Humor, der kein bisschen verstaubt ist. Vielmehr klingt vieles heute, nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, Jugoslawiens und im Zuge der wieder erwachenden nationalistischen Kleinstaaterei, wie traurig wahr gewordene Voraussagungen.
Alles beginnt wie das Buch der Bücher mit dem "Wort", hier als Eintrag in einer wirr anmutenden Enzyklopädie, die ein Vorfahre des Autors, der serbisch-orthodoxe Priester Theodor, im Jahre 1828 in der damals zu Österreich-Ungarn gehörenden fiktiven Kleinstadt Grunt in Slawonien zusammenstellt. Der deutsch klingende Name gehört durchaus zum ästhetischen Programm, und wer bei Slawonien, ein Landstrich im Osten Kroatiens, an Schlawiner denkt, ist, zumindest was den Schalk im Wort ausmacht, auch nicht so ganz auf dem Holzweg. Für Theodor ist das "Wort" ein "Buchstabenstapel", der sich zu einem Gegenstand formt, "den der eine versteht, der andere nicht". Die Hoheit der Kirche über die Sprache ist längst passé, eine neue Ordnung der Dinge muss her. Mit seiner keinem nachvollziehbaren System folgenden Sammlung, in der sich Göttliches und Weltliches auf urkomische Weise mischen - die Schwiegermutter mit dem Teufel, Geschlechtskrankheiten wie "Franzosen bekommen" mit Psalter und Paprikasch -, ist Theodor der erste in einer Reihe von Dokumentier- und Sortierwütigen in dieser so gar nicht außergewöhnlichen Familie.
Spätestens beim zweiten Buch wird deutlich, dass der Roman, aufgebaut wie der alttestamentarische Pentateuch, nicht den Gesetzen landläufiger Prosawerke folgt. Es geht nicht so sehr um die Figuren, sondern um eine Neuvermessung der Welt mittels der Sprache. Aus Monologen und Possenspielen, Listen von Gesetzen und Verordnungen, Rezepten, Neuigkeiten und Überliefertem, Buchtiteln und Volksplatituden wie "Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu" entsteht ein polyphones Welttheater, aufgeführt in einem Hinterzimmer Europas, das zum Versuchslabor der Moderne umgebaut wurde. Gespielt wird es von unbedarften Kleinbürgern, denen die Welt letztlich egal ist.
Auf Theodor folgt 1871 Katharina, seine Schwiegertochter, eine kluge Geschäfts- und Hausfrau, die, aus kroatischem Adel stammend, ihrem Mann zuliebe zur Orthodoxie konvertierte und deshalb von ihrer reichen Familie enterbt wurde. In ihren Aufzeichnungen vermengen sich Häusliches und Geschäftliches, Politisches und Privates, kassandraartige Prophezeiungen über die Verwerfungen des kommenden Jahrhunderts und betuliche Bilderbögen, in denen der Kaiser als beschränkter Biedermann herumgeistert. Katharinas "Gott und die Leut" wird zu einem literarischen Monumentalbild, ein Hieronymus Bosch in Worten. Es gipfelt in einem volkstümlich gereimten Endzeitmonolog: "Nach dem jüngsten Gericht weilen im Paradies nur ein paar alte Frauen, die auf die Erde schauen, dazu einige Krüppel und Chinesen, die sind zu kurz am Leben gewesen."
Mittels des Theaters, das in einem dadaistisch anmutenden Volksstück daherkommt, wird die nächste Tutorin, Laura, Katharinas aus Graz stammende deutsche Schwiegertochter, eingeführt. Sie reist vor dem Ersten Weltkrieg in einem Zugabteil mit dem geschwätzigen Provinzler Hinko Hinkovic nach Paris, ihrem Mann, einem Arzt hinterher. Die ihr neue Welt des Massenkonsums entdeckt sie durch Werbeslogans und Ratgeberliteratur. Seitenweise folgen wir absurden "Regeln für Überraschungsgäste" oder - als sei's ein Ich-bin-doch-nicht-blöd-Spruch von heute - "Schicken Sie Geld, die Ware existiert nicht". Mit Lazar, Lauras Schwiegersohn, und seiner Frau Danica gelangen wir schließlich ins Jahr 1938 und von dort bis in die Nachkriegsepoche. Lazar ist Handlungsgehilfe und Taugenichts, den es nach Belgrad verschlagen hat, wo er sich mit Saufgelagen und Hurerei die Zeit vertreibt. Danica liest Groschenromane und Frauenzeitschriften, ihre Gedanken kreisen um das traute Heim; ihre Sorge gilt ihrem Sohn Bora und dabei vor allem der Tatsache, dass er mit einem "kleinen Juden" mit der Tram die Großstadt erkundet.
Zwischen all dem Geplapper verstecken sich die wahren Tragödien der Familie und der Geschichte. So erfährt man in Nebensätzen, dass Katharina ermordet wurde, Lauras Mann einem Hochverratsprozess entging und an der Spanischen Grippe starb und Danica von Lazar für eine Kassiererin sitzengelassen wurde. Er starb an der "Leber", wie praktisch jeder Zweite. Hitler, Stalin, der Holocaust, Kriege und der Zusammenbruch von Imperien, alles kommt in Platituden daher, verdreht in einer Art Stille-Post-Spiel. Die wahre Heldin dieses großen, sich dem Leser nicht ganz leicht erschließenden europäischen Romans ist die Sprache, jene, wie es der Autor in seinem Nachwort schreibt, fremde, dem Volk übergestülpte Sprache, eine Nicht-Sprache, in der sich "immer alles findet, im Guten wie im Bösen". Nur was genau sich da finden soll, haben die Helden vergessen.
SABINE BERKING.
Bora Cosic: "Die Tutoren". Roman.
Aus dem Serbischen von Brigitte Döbert. Verlag Schöffling & Co., Frankfurt am Main 2015. 800 S., geb., 39,95 [Euro]. Unter www.die-tutoren.de bietet der Verlag einen Ergänzungsband als kostenloses E-Book: Sabine Baumann (Hrsg.): "Der große Roman Europas - Bora Cosic: ,Die Tutoren'." 128 S., Material, Texte, Fotos.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main