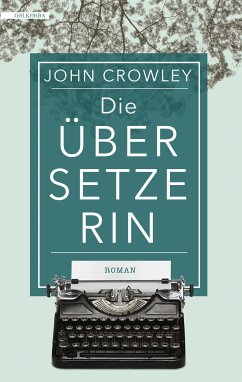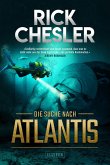Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

John Crowley ist ein bei uns kaum bekannter, von Kennern verehrter Meister der Phantastik. In "Die Übersetzerin" kann man ihn jetzt auf Deutsch entdecken.
Von Dietmar Dath
Die Leserin verrät dem Schriftsteller, dass sie gerade sein Gedicht gelesen hat. Er widerspricht: "Nein, nein, nicht mein Gedicht." Sie wundert sich, denn der Text, den sie meint, hat doch, wenn das kein Druckfehler ist, als Autor den, mit dem sie jetzt redet, Innokenti Issajewitsch Falin. Der begründet seine Weigerung, sich für den zu halten, der geschrieben hat, was in dem Buch steht, das sie meint, so: "Mein Gedicht war ein Gedicht in russischer Sprache. Das Gedicht in diesem Buch ist ein Gedicht - vielleicht ein Gedicht - auf Englisch. Ich glaube, das ist es, was Sie gelesen haben." Sie fragt, ob er damit die Übersetzung beanstanden wolle. Er sagt, er könne die Übersetzung nicht beurteilen, aber doch erkennen: "Sie enthielt keine Reime, und mein Gedicht reimte sich und hatte ein bestimmtes Maß. Dem im Buch fehlte das Versmaß, jedenfalls ist mir keines aufgefallen. Auf Englisch sind es freie Verse. Zwei Gedichte, die sich so sehr unterscheiden, können nicht dasselbe sein." Selbst wo er Verwandtschaft einräumen muss, lehnt er die Autorschaft ab: "Mein Gedicht und dieses Gedicht handeln von denselben Dingen. Vielleicht. Trotzdem sagen sie nicht dasselbe darüber aus."
Dass obendrein der Wortlaut der Übersetzung den Gegenstand der Dichtung verfehlt, was Falin schließlich auch noch nachweist, ist nur der Epilog zu dieser sehr kurzen Tragödie des Nichtverstehens, einer Schlüsselszene in dem Roman "The Translator" von John Crowley, den André Taggeselle in einen deutschen Text namens "Die Übersetzerin" gerettet hat. Wirklich: gerettet, nicht einfach übertragen, sondern in Sicherheit gebracht vor vielen Gefahren, die in diesem Buch auf das Lesen lauern, wenn es vorschnell begreifen will, und aufs Übersetzen, wenn es nicht weiß, dass es sich hier an das Prinzip halten muss, das der Philosoph Donald Davidson einmal als Grundlage allen Verstehens beschrieben hat, die "wohlwollende, aber radikale Auslegung", das heißt die Bereitschaft, einerseits kein Wort für selbstverständlich zu halten (also jedes ganz grundsätzlich, eben: radikal, für auslegungsbedürftig), andererseits aber immer dann, wenn etwas keinen Sinn zu ergeben scheint, den Fehler bei der Auslegung zu suchen statt bei der Äußerung, die interpretiert wird (eben: wohlwollend).
Liest man das Buch nicht so, sondern mit der Buchkonsum-Brille, die bei jedem Wort eh weiß, wie es zu verstehen ist, und der dann eben der Begriff etwa von Liebe dermaßen trostlos zur Floskel verkommen ist, dass sie einfallslos sterile Städteschriftstellerei mit Formeln wie "eine Liebeserklärung an Paris" goutiert oder von ihrer "Liebe zum guten Essen" faselt, dann wird man bei John Crowley an ungelöschtem Wissendurst und ungestilltem Verständnishunger kaputtgehen, wenn man ihn nicht einfach beiseitelegt, weil man ihn so nichtssagend findet, wie das eigene Vokabular längst ist.
Schon der Titel "The Translator" ist im Englischen mehrdeutiger, als er im Deutschen sein kann, nämlich geschlechtlos. Auf den ersten Blick bezeichnet er die Frau in der zitierten Stelle, Christa "Kit" Malone, die schließlich übersetzen wird, was der Mann, jener aus der Sowjetunion in die Vereinigten Staaten geflohene Dichter Falin, geschrieben hat. In einem tieferen Sinn aber ist auch er Übersetzer, Vermittler von einander inkommensurablen Monologen ganzer Kulturkreise womöglich, und es kann sein, dass er sogar eine ausgleichende, rettende Rolle bei der Kuba-Krise im Oktober 1962 gespielt hat, die das Menschengeschlecht nah an die Schwelle der Auslöschung mittels Atomwaffen gebracht hat. Man kann's nicht wissen, das Buch sagt es nicht, es lässt Falin verschwinden, nur ein Auto, in einen Fluss gestürzt und leer, bleibt von ihm.
John Crowley ist ein bei Kolleginnen und Kollegen vielbewunderter Mann, der im Stillen arbeitet, abgewandt vom Betrieb nicht aus Stolz und Trotz, sondern um der Konzentration aufs Werk willen. Harold Bloom, gnostischer Kauz, Gelehrter und bissiger Konservativer in Kanonfragen, zählt Crowleys erstes Hauptwerk "Little, Big" (1981), eine moderne Feenromanze in der Tradition von Edmund Spensers unvollendetem Versepos "The Faerie Queene" (1596) zu den Werken, die sein Leserleben verändert haben, weil sich darin die Welt der höheren, zeitenthobenen Wahrheiten nicht, wie in der meisten modernen Phantastik, außerhalb des Alltags, zu erreichen nur über Spiegel oder Portale, sondern in den vernachlässigten Winkeln des Bekannten, Ritzen, Falten, unter alten Treppen und in verwahrlosten Gärten findet und weil es desto größer wird, je tiefer man sich ins Kleinste schlängelt. Diese vollkommene Allegorie auf alle Wege und Irrwege menschlicher Begegnungen mit dem Außer- und Übermenschlichen seit der Renaissance war für Crowley selbst indes nur ein Vorspiel fürs zweite Hauptwerk: Die vier Bände des "Aegypt"-Quartetts "The Solitudes" (1987), "Love & Sleep" (1994), "Daemonomania" (2000) und "Endless Things" (2008) vermählen Historiographie und Philologie zu einer neuen Weltgeschichte als Weltlektüre, entwickelt aus einer eigenen, neuen Vorstellung davon, was "das Historische" eigentlich sei, nämlich weder linear wie die christliche Heils- oder die moderne Fortschrittsgeschichte noch zyklisch wie bei Giambattista Vico oder Oswald Spengler.
Die Zeit ereignet sich da in Brüchen, die nur Sprache überbrücken kann: Geschichte beginnt immer wieder neu, alles, was wirklich war, wird vollständig vergessen und ersetzt durch eine neue Vergangenheit, die zur neuen Gegenwart passt. Die Welt mag einmal wirklich verzaubert gewesen sein, wurde dann vernünftig und wird eines Tages etwas anderes, heute noch Undenkbares sein.
Dichtungen, glaubt Crowley, können Vergessenes wissen und Zukünftiges sagen. "Die Übersetzerin" aber handelt nicht von dieser großen Idee allein, sondern davon, wie wir mit ihr leben könnten, wenn sie wahr wäre.
John Crowley: "Die Übersetzerin". Roman.
Aus dem Amerikanischen von André Taggeselle.
Golkonda Verlag, München 2017. 450 S., geb., 22,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main