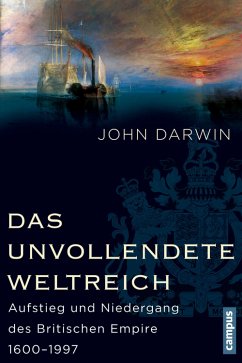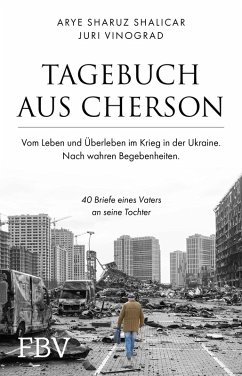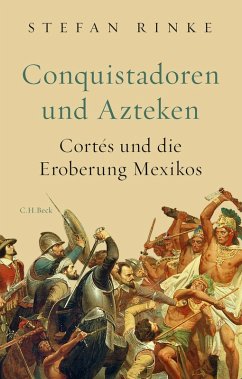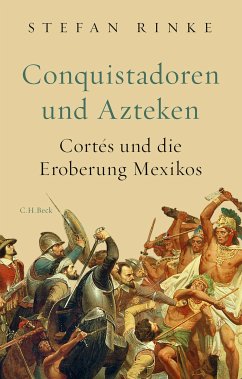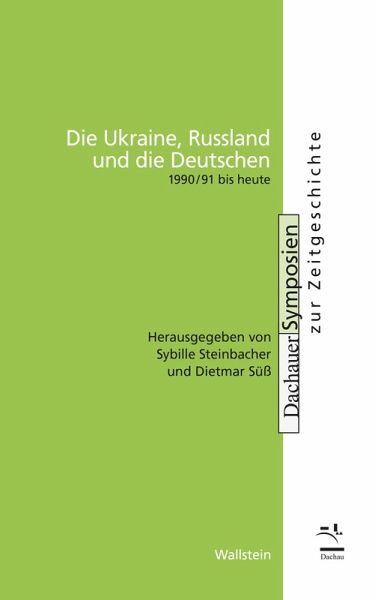
Die Ukraine, Russland und die Deutschen (eBook, PDF)
1990/91 bis heute
Redaktion: Steinbacher, Sybille; Süß, Dietmar
Sofort per Download lieferbar
Statt: 20,00 €**
19,99 €
inkl. MwSt.
** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine: Historische Einordnung und geschichtspolitische Folgen Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die europäische Sicherheitsarchitektur grundlegend verändert. Zudem berührt er aber auch die Frage, ob sich bestehende Formen des Umgangs mit dem Nationalsozialismus in Deutschland und Europa im Zeichen des Krieges verschieben. Welche Rolle spielt die Erinnerung an die deutsche Besatzungs- und Vernichtungspolitik in Osteuropa überhaupt in diesem Krieg, dessen Vorgeschichte oft noch viel zu wenig berücksichtigt wurde? Die Autorinnen und Aut...
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine: Historische Einordnung und geschichtspolitische Folgen Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die europäische Sicherheitsarchitektur grundlegend verändert. Zudem berührt er aber auch die Frage, ob sich bestehende Formen des Umgangs mit dem Nationalsozialismus in Deutschland und Europa im Zeichen des Krieges verschieben. Welche Rolle spielt die Erinnerung an die deutsche Besatzungs- und Vernichtungspolitik in Osteuropa überhaupt in diesem Krieg, dessen Vorgeschichte oft noch viel zu wenig berücksichtigt wurde? Die Autorinnen und Autoren des Bandes nähern sich diesen Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven, um sowohl das ukrainisch-russisch-deutsche Beziehungsgeflecht seit den 1990er-Jahren als auch den 24. Februar 2022 als mögliche geschichtspolitische Zäsur zu untersuchen. Beleuchtet werden dadurch etwa der Umgang mit der Massengewalt im 20. Jahrhundert, neue Formen imperialer Politik, zivilgesellschaftliche Initiativen, außenpolitische Interessen und religiöse Legitimationsformen des gegenwärtigen Krieges. Aus dem Inhalt: Martin Aust: Indifferenz, Differenzierung und Neo-Imperialismus. Russland und das Erbe der Imperien seit 1991 Franziska Davies: Verdrängen, erinnern, aufarbeiten. Vom Umgang mit Holodomor und Holocaust in der Ukraine Volkhard Knigge: "Faschismus", "Vernichtungskrieg", "Völkermord". NS-Begrifflichkeiten im Spannungsfeld von Mobilisierung und Erkenntnis.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.