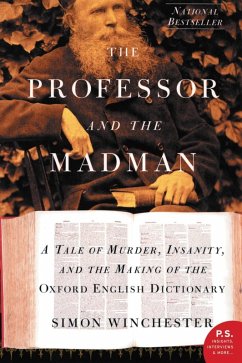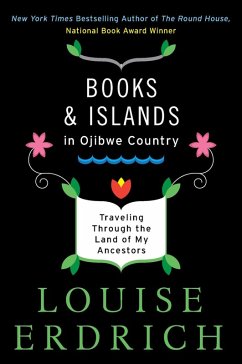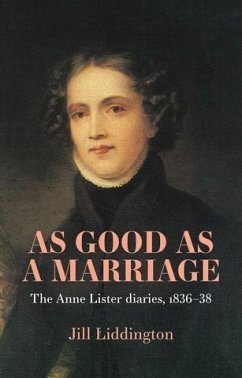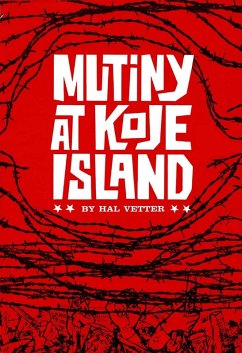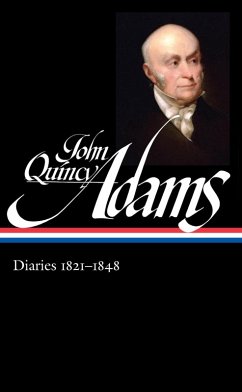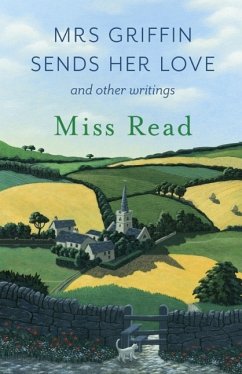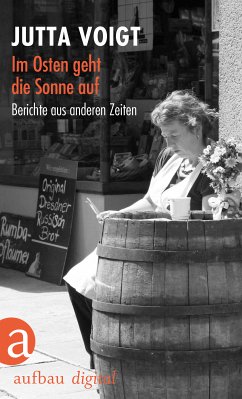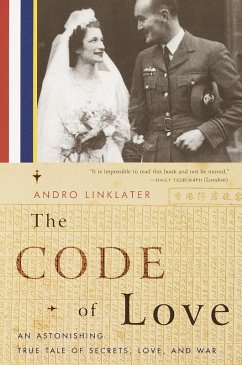Die unendliche Heilung (eBook, ePUB)
Aby Warburgs Krankengeschichte
Redaktion: Stimilli, Davide; Marazia, Chantal / Übersetzer: Schulz, Sabine
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
34,95 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Zwischen April 1921 und August 1924 war Aby Warburg, der geniale Kunsthistoriker und Kulturwissenschaftler, Insasse im Sanatorium Bellevue in Kreuzlingen, wohin er nach einem schweren psychotischen Zusammenbruch eingewiesen worden war - er hatte gedroht, sich und seine Familie umzubringen. Leiter der psychiatrischen Heilanstalt war Ludwig Binswanger, seinerseits bedeutender Psychiater, dessen Erkenntnisse den Zugang zur Geisteskrankheit tiefgreifend verändern sollten. Bislang war aus dieser Zeit nicht viel mehr allgemein bekannt, als dass Warburg vor seinen Mitpatienten den berühmten Vortra...
Zwischen April 1921 und August 1924 war Aby Warburg, der geniale Kunsthistoriker und Kulturwissenschaftler, Insasse im Sanatorium Bellevue in Kreuzlingen, wohin er nach einem schweren psychotischen Zusammenbruch eingewiesen worden war - er hatte gedroht, sich und seine Familie umzubringen. Leiter der psychiatrischen Heilanstalt war Ludwig Binswanger, seinerseits bedeutender Psychiater, dessen Erkenntnisse den Zugang zur Geisteskrankheit tiefgreifend verändern sollten. Bislang war aus dieser Zeit nicht viel mehr allgemein bekannt, als dass Warburg vor seinen Mitpatienten den berühmten Vortrag über das Schlangenritual der Hopi-Indianer hielt. Tatsächlich hatte er während seiner Krankheit immer wieder Phasen von geistiger Klarheit und schöpferischer Produktivität. Binswangers Krankenberichte dokumentieren Wahnvorstellungen, Aggressivität gegen das Personal, Phobien und zwanghafte Hygienerituale. Warburg, der sich selbst als »unheilbar schizoid« einschätzte, wurde erst 1924 »zur Normalität beurlaubt«.
Die hochgelobte Edition der im Universitätsarchiv Tübingen verwahrten Krankengeschichte Aby Warburgs erfüllt ein lange gehegtes Desiderat der Warburg-Forschung. Mit der nun auch auf Deutsch vorliegenden, gegenüber der italienischen um wichtige Dokumente erweiterten Ausgabe kann endlich darangegangen werden, die »Leerstelle« zwischen Werk und Psyche Warburgs zu schließen, die von seinen Biographen wie etwa Ernst Gombrich geflissentlich verschwiegen wurde.
Der Band umfasst neben den Krankenakten von der Hand Ludwig Binswangers auch die autobiographischen Aufzeichnungen Warburgs aus jener Zeit, den Briefwechsel zwischen den beiden Persönlichkeiten, Wärterprotokolle sowie Aufzeichnungen und Briefe von Warburgs Assistenten Fritz Saxl. »Die unendliche Heilung« wird zum einmaligen Zeugnis der Begegnung zweier bedeutender intellektueller Protagonisten des 20. Jahrhunderts.
Die hochgelobte Edition der im Universitätsarchiv Tübingen verwahrten Krankengeschichte Aby Warburgs erfüllt ein lange gehegtes Desiderat der Warburg-Forschung. Mit der nun auch auf Deutsch vorliegenden, gegenüber der italienischen um wichtige Dokumente erweiterten Ausgabe kann endlich darangegangen werden, die »Leerstelle« zwischen Werk und Psyche Warburgs zu schließen, die von seinen Biographen wie etwa Ernst Gombrich geflissentlich verschwiegen wurde.
Der Band umfasst neben den Krankenakten von der Hand Ludwig Binswangers auch die autobiographischen Aufzeichnungen Warburgs aus jener Zeit, den Briefwechsel zwischen den beiden Persönlichkeiten, Wärterprotokolle sowie Aufzeichnungen und Briefe von Warburgs Assistenten Fritz Saxl. »Die unendliche Heilung« wird zum einmaligen Zeugnis der Begegnung zweier bedeutender intellektueller Protagonisten des 20. Jahrhunderts.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.