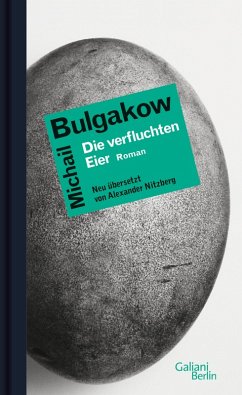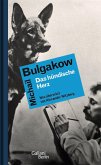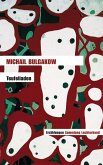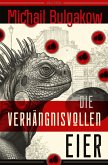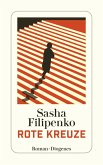Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Überraschungen aus Testosteron: Michail Bulgakows funkensprühendes Frühwerk "Die verfluchten Eier" zeigt den vorstalinistischen Teufelsspuk. Jetzt liegt es in einer kongenialen Neuübersetzung vor.
Das Vergnügen, das die Frühwerke des für seinen Roman "Der Meister und Margarita" berühmten Michail Bulgakow uns Heutigen bereiten, ähnelt der Freude, die einer, der Schostakowitschs große Symphonien aus der Stalin-Zeit im Ohr hat, beim Hören von dessen "Nase" empfindet: Man erlebt den durch tragische Lebenserfahrung gereiften Meister, wie man ihn liebt und bewundert, noch einmal im schäumenden Kräfteüberschuss seiner Jugend, wie den Kampfstier am Anfang der Corrida, vor seinem Zusammenstoß mit dem Picador. Und dank der kongenialen, poetisch bissigen Neuübersetzung von Bulgakows wichtigsten Büchern durch Alexander Nitzberg erreicht dieses testosterongeladene Sprachfeuerwerk heute auch das deutsche Publikum.
Bulgakow war 33 Jahre alt und hatte schon, wie in seinem Alter auch Schostakowitsch, sein muskulöses Satiregenie glänzend unter Beweis gestellt, als er 1924 seinen Kurzroman "Die verfluchten Eier" schrieb, inspiriert von der "Neuen ökonomischen Politik" mit ihrer abenteuerlichen Geschäftemacherei und dem nicht weniger abenteuerlichen Glauben, komplexe Probleme schnell lösen zu können. Eine russische Wissenschaftskoryphäe, die sich über Revolution und Kriegskommunismus hinweg in die "Neue ökonomische Politik" hinübergerettet hat, da plötzlich alles erlaubt scheint, entdeckt einen ausschließlich im Labor erzeugbaren roten Lichtstrahl, der lebendige Organismen furios wachsen und sich vermehren lässt - und das just in der von Bulgakow in die nahe Zukunft von 1928 projizierten Zeit der Handlung, da eine geheimnisvolle Seuche wie auf Satans Kommando sämtliche Hühner im Lande der Sowjets dahinrafft. Der Professor wird berühmt, seine Erfindung soll auf einem Musterlandgut die Hühnerpopulation wieder auferstehen lassen. Doch infolge eines Postfehlers werden die spezialverpackten Hühnereier aus dem Ausland ans hauptstädtische Labor geliefert, während das Landgut die Straußen-, Lurch- und Schlangeneier bekommt, die der Professor für seine weiterführende Forschung bestellt hatte.
In dem zu Unrecht oft als zweitrangig abgetanen Buch persifliert Bulgakow die absehbare kommunistische Zukunft. Er rechnet die wilden zwanziger Jahre in Sowjetrussland mit ihrer Mischung aus entfesseltem Sendungsbewusstsein und leichtsinniger Vergnügungssucht hoch zu einer völlig verantwortungslosen Gesellschaft, die mit Plündererzynismus die Besitztümer der vertriebenen Aristokratie unter sich aufgeteilt, sich der politischen Führung durch geheimdienstliche Finsterlinge anheimgegeben und sich hündisch von deren Auserwähltheitswahn hat anstecken lassen. Das versetzt er in eine Zaubermärchenwelt, wo die rationalen Steuerungsfunktionen ausgeschaltet sind. Wenn Bulgakow in seiner Fabulierekstase dann noch den Theaterrevolutionär Wsewolod Meyerhold, der im Todesjahr des Autors selbst, 1940, in den Kellern des KGB exekutiert wurde, durch einen bühnentechnischen Unfall in einer grotesken Boris-Godunow-Inszenierung schon 1927 ums Leben kommen lässt, so taucht dieser literarische Scherz die "vegetarische" Vorstalinzeit vollends ins Schummerlicht eines Teufelsspuks, die sie in den Augen der Stalinismus-Überlebenden Anna Achmatowa auch im Rückblick tatsächlich war. Bezeichnenderweise ist die Teufelsfigur der Staatssicherheitsagent, der vom Professor dessen Versuchsgeräte requiriert, ein revolutionsbedingt gefallener Engel: Vor dem Krieg war der Mann Flötist.
In Eiern, über die infolge der Hühnerseuche Bulgakows Journalisten, Kabarettisten, Songschreiber obsessiv Witze reißen, stecken - damals wie heute und überall - männliche Potenz, weibliche Fruchtbarkeit und die Überraschungen des Lebens. Als in der Musterkolchose aus Deutschland drei Kisten mit Eiern eintreffen, deren Größe alle Normen sprengt, sind die Kummer gewöhnten Empfänger hell begeistert. "Das nenne ich deutsche Eier!", frohlockt der das Projekt beaufsichtigende Agent. "Das ist mal ein anderes Kaliber als die Eier unserer Bauernlümmel."
Während der Brutzeit zeigt sich zunächst nur die Natur beunruhigt. Trotz schönsten Sommerwetters fliegen alle Vögel davon, die Frösche im Teich verstummen, nur die Hofhunde bellen und können sich nicht beruhigen. Plötzlich entsteigen den strahlenstimulierten Überraschungseiern gewaltige Laufvögel, Riesenschlangen, Megakrokodile, die das Gutspersonal einfach auffressen, aber auch von den Truppen des Geheimdienstes, ja nicht mal von der legendären Reiterarmee des revolutionären Kavallerieführers Budjonny aufgehalten werden können, sondern losmarschieren Richtung Moskau, eifrig Eier legend, sich vermehrend wie ein Flächenbrand, so dass Russlands mythischer Kriegsverbündeter, General Frost, einschreiten muss, angesichts der akuten Notlage sogar ausnahmsweise im August, um das Höllenspektakel zu beenden.
KERSTIN HOLM
Michail Bulgakow: "Die verfluchten Eier". Roman.
Aus dem Russischen übersetzt von Alexander Nitzberg. Galiani Verlag, Berlin 2014. 144 S., geb., 16,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main