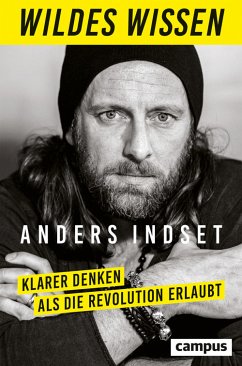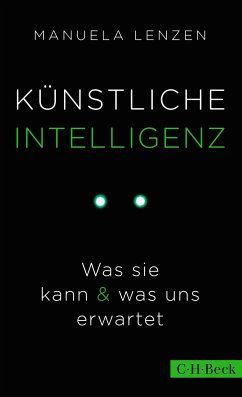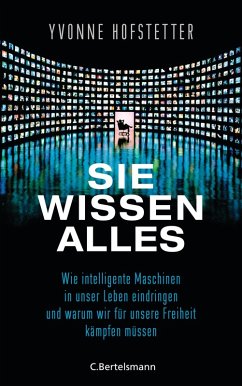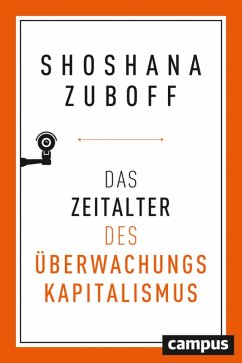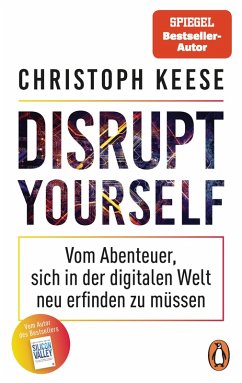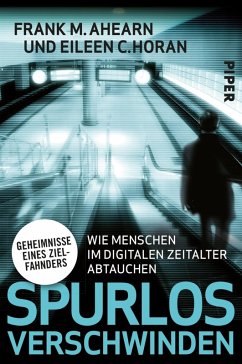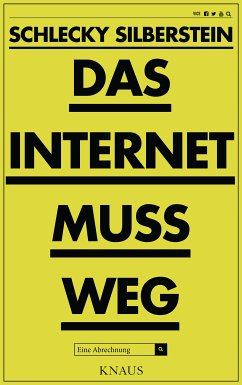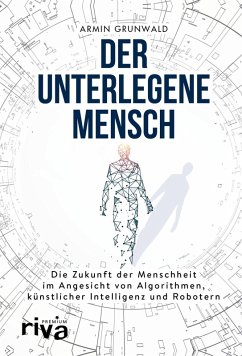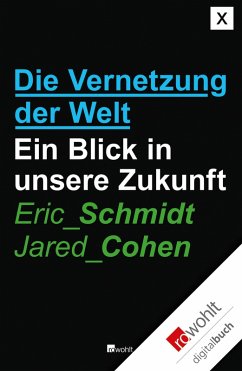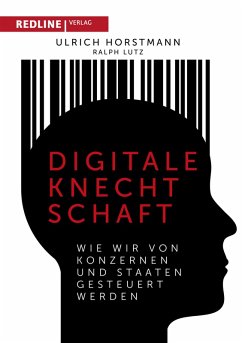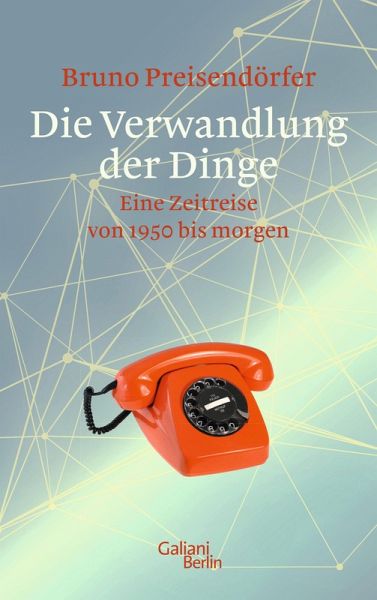
Die Verwandlung der Dinge (eBook, ePUB)
Eine Zeitreise von 1950 bis morgen
Sofort per Download lieferbar
Statt: 20,00 €**
16,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die Verwandlung der Dinge: Eine faszinierende Zeitreise durch die Geschichte der Alltagsgegenstände Bestsellerautor Bruno Preisendörfer nimmt uns mit auf eine spannende Reise durch die Geschichte der Alltagsgegenstände und wie sie unser Leben verändert haben. In seinem neuesten Werk Die Verwandlung der Dinge blickt er zurück auf seine eigenen Erfahrungen seit den 1960er Jahren und reflektiert mit Neugier, Nostalgie und verschmitztem Staunen über die rasante technologische Entwicklung. Von der Schiefertafel über den Rechenschieber bis hin zu Fernseher, Radio und Schreibmaschine - Preisen...
Die Verwandlung der Dinge: Eine faszinierende Zeitreise durch die Geschichte der Alltagsgegenstände Bestsellerautor Bruno Preisendörfer nimmt uns mit auf eine spannende Reise durch die Geschichte der Alltagsgegenstände und wie sie unser Leben verändert haben. In seinem neuesten Werk Die Verwandlung der Dinge blickt er zurück auf seine eigenen Erfahrungen seit den 1960er Jahren und reflektiert mit Neugier, Nostalgie und verschmitztem Staunen über die rasante technologische Entwicklung. Von der Schiefertafel über den Rechenschieber bis hin zu Fernseher, Radio und Schreibmaschine - Preisendörfer beleuchtet mit stilistischer Raffinesse, wie diese Kulturtechniken unser Sozialgefüge beeinflusst haben. Er zeigt, wie sich das gemeinsame Fernsehen von der Tablet-Nutzung unterscheidet, wie sich das Musikhören von der LP zum Streaming gewandelt hat und wie das Telefon die Kommunikation revolutioniert hat. Mit wachem Blick und philosophischem Tiefgang ergründet Preisendörfer die Bedeutung dieser Alltagsgegenstände für uns als Individuen und als Gesellschaft. Die Verwandlung der Dinge ist eine fesselnde Betrachtung darüber, wie Technologie unsere Vergangenheit geprägt hat - und wie sie unsere Zukunft gestalten wird.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.




 buecher-magazin.deDas Grundproblem vieler historischer Bücher besteht darin, dass ihre Autoren zwar unglaublich viel wissen, dieses Wissen jedoch kaum in sprachlich ansprechender Form zu vermitteln verstehen. Dieses Problem hat Bruno Preisendörfer nicht. Seine letzten beiden Bücher, in denen er uns auf Reisen in die Goethe- und die Lutherzeit mitgenommen hat, sind nicht umsonst zu kleinen Bestsellern geworden. Dieses Mal reist der Autor in seiner "Zeitreise von 1950 bis morgen" nicht ganz so weit in die Vergangenheit, was den Vorteil hat, dass die meisten seiner Leser jede Menge Wiedererkennungseffekte haben. Ob es das Wählscheibentelefon ist oder die LP, ob Preisendörfer über den Weg vom klobigen TV-Gerät zum Online-Streaming schreibt oder ob es um die Medien geht, mit denen wir Texte verfassen und rezipieren: Immer weiß der Historiker launig, jedoch trotzdem wissenschaftlich exakt zu erzählen, immer hat der Leser einen überraschenden Erkenntnisgewinn in Verbindung mit Spaß an der Lektüre. Preisendörfer führt uns die Verwandlung der Dinge so plastisch vor Augen, dass wir ebenfalls zu begreifen beginnen, wie die Dinge auch uns und unseren Geist verwandeln. Tempora mutantur, nos et mutamur in illis: Dieses Buch ist die beste Illustration dieses ewig gültigen Satzes.
buecher-magazin.deDas Grundproblem vieler historischer Bücher besteht darin, dass ihre Autoren zwar unglaublich viel wissen, dieses Wissen jedoch kaum in sprachlich ansprechender Form zu vermitteln verstehen. Dieses Problem hat Bruno Preisendörfer nicht. Seine letzten beiden Bücher, in denen er uns auf Reisen in die Goethe- und die Lutherzeit mitgenommen hat, sind nicht umsonst zu kleinen Bestsellern geworden. Dieses Mal reist der Autor in seiner "Zeitreise von 1950 bis morgen" nicht ganz so weit in die Vergangenheit, was den Vorteil hat, dass die meisten seiner Leser jede Menge Wiedererkennungseffekte haben. Ob es das Wählscheibentelefon ist oder die LP, ob Preisendörfer über den Weg vom klobigen TV-Gerät zum Online-Streaming schreibt oder ob es um die Medien geht, mit denen wir Texte verfassen und rezipieren: Immer weiß der Historiker launig, jedoch trotzdem wissenschaftlich exakt zu erzählen, immer hat der Leser einen überraschenden Erkenntnisgewinn in Verbindung mit Spaß an der Lektüre. Preisendörfer führt uns die Verwandlung der Dinge so plastisch vor Augen, dass wir ebenfalls zu begreifen beginnen, wie die Dinge auch uns und unseren Geist verwandeln. Tempora mutantur, nos et mutamur in illis: Dieses Buch ist die beste Illustration dieses ewig gültigen Satzes.