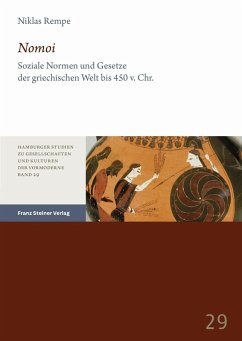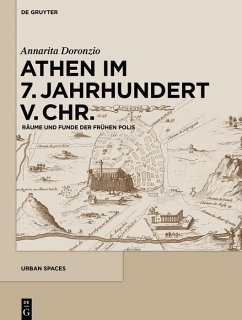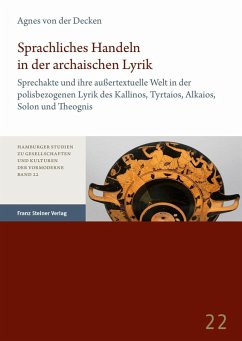Die Verwendung und Bedeutung von Losverfahren in Athen und im griechischen Raum vom 7. bis 5. Jahrhundert v. Chr. (eBook, PDF)
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
58,00 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
In der Diskussion zur Krise moderner Demokratien erfreut sich das Losen einer wachsenden Aufmerksamkeit. Dabei wird oft auf die Verwendung von Losverfahren in der politischen Praxis der griechischen Antike verwiesen. Jedoch kam dem Losen auch in anderen Bereichen eine wichtige Funktion zu. Aaron Gebler fokussiert in seiner Studie ebendiese Bereiche und untersucht umfassend die Verwendung von Losverfahren in der attischen Demokratie im 6. und 5. Jahrhundert v. Chr. Er zeigt, dass die Verwendung des Loses im politischen Kontext möglicherweise aus dem militärischen Bereich übernommen wurde. Im...
In der Diskussion zur Krise moderner Demokratien erfreut sich das Losen einer wachsenden Aufmerksamkeit. Dabei wird oft auf die Verwendung von Losverfahren in der politischen Praxis der griechischen Antike verwiesen. Jedoch kam dem Losen auch in anderen Bereichen eine wichtige Funktion zu. Aaron Gebler fokussiert in seiner Studie ebendiese Bereiche und untersucht umfassend die Verwendung von Losverfahren in der attischen Demokratie im 6. und 5. Jahrhundert v. Chr. Er zeigt, dass die Verwendung des Loses im politischen Kontext möglicherweise aus dem militärischen Bereich übernommen wurde. Im Zuge einer Transformation der Partizipationskultur im griechischen Raum etablierte sich im 5. Jahrhundert v. Chr. das Losverfahren zu einer bedeutenden Technik. Wurde es im 7. und 6. Jahrhundert v. Chr. noch beliebig eingesetzt - meist als Problemlöser einer spezifischen Situation im militärischen Kontext, zur Verteilung von Erbschaften oder zur Befragung der Götter -, entwickelte sich das Losverfahren spätestens ab den letzten Jahren des 6. Jahrhundert v. Chr. zu einem festen Bestandteil politischer Ordnungen.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.