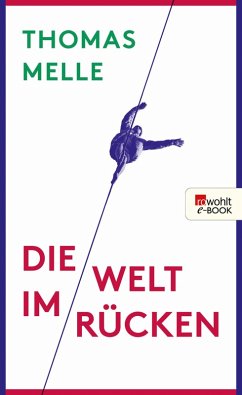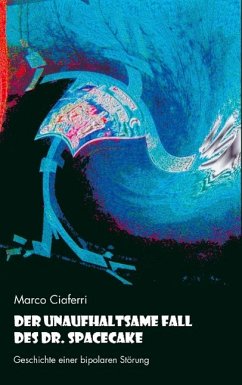Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Zeig her deine Schmerzen: Thomas Melle liest in Frankfurt aus "Die Welt im Rücken"
Gut getarnt sei er gewesen, sagt Thomas Melle im Frankfurter Literaturhaus. Gerade hat sein Gesprächspartner, der HR-Redakteur Alf Mentzer, ihn an den Abend im September 2014 erinnert, an dem beide am selben Ort Melles kurz zuvor erschienenen Roman "3000 Euro" vorgestellt haben. Und Mentzer hat seinen Schriftstellergast gefragt, ob er als sorgfältiger Fragender bestimmten Passagen des Buches seinerzeit Melles manisch-depressive Erkrankung hätte anmerken müssen. Nein, sagt der Autor: "Es lag an der ausreichenden Camouflage auf meiner Seite."
Nun ist Melle in den ausverkauften Lesesaal zurückgekommen, um "Die Welt im Rücken" vorzustellen, das Buch, an das er sich machte, als er die Dauertarnung seines Leidens satt hatte. Voriges Jahr hat die Jury des Deutschen Buchpreises es zu Recht auf die Shortlist der Auszeichnung gesetzt, die sie später Bodo Kirchhoffs Novelle "Widerfahrnis" zuerkannte. "Die Welt im Rücken" beweist für Mentzer, dass nicht jedes Shortlistbuch, das am Ende ohne den Hauptpreis ausgeht, für den Buchhandel so verloren sei wie von den Verlagen oft beklagt: "Es unterläuft die Regeln der Aufmerksamkeitsökonomie souverän."
Souverän. Die Herrschaft über seine Krankheit wollte Melle erlangen. Schon einmal hat er sein Buch im Literaturhaus erklärt. Anfang Oktober vergangenen Jahres ist das gewesen, auf der Lesung sämtlicher Shortlistautoren bis auf Kirchhoff, der wenige Tage später am selben Ort auftrat. Wie damals erklärt Melle nun, der Entschluss zum Verfassen des Buches sei für sein Leben und sein Schreiben gleichermaßen wichtig gewesen - auf dass beides ein wenig freier werde von einer lange getragenen Last. Die von ihm betonte Notwendigkeit, "dem Ganzen eine Form zu geben", bezieht sich nicht nur auf das möglichst gute Schreiben des Buches.
Auch wenn ihm diese Seite seiner Tätigkeit gerade bei "Die Welt im Rücken", dem Bekenntnisbuch, dessen Gattungszugehörigkeit sich nur schwer bestimmen lässt, besonders wichtig ist. "Es ist etwas Gemachtes", sagt Melle und fügt eine paradoxe Formulierung hinzu: "Authentizität kann man nur erreichen, wenn es durch die Kunst gegangen ist." Dieser Krankheit, heißt das, wird man erst gerecht, wenn man sich bei ihrer Beschreibung etwas einfallen lässt: "All das muss aufgeblättert und erzählt werden." Nicht bloß berichtet und sorgfältig durchdacht wie in einem Essay, sondern mit etwas mehr Handlungsschwung und persönlicher Beteiligung, schließlich gilt es, eine Manie in den Kunstgriff zu bekommen, in deren Verlauf Welt und Wörter ihre feste, eindeutige und verlässliche Bedeutung verlieren und der Kranke jeden Halt verliert: "Alles kann alles bedeuten. Auch ich kann alles bedeuten."
Von drei schweren manischen Schüben erzählt Melle, langgezogenen Episoden, die ihn zwischen 1999 und 2010 aus der Bahn warfen. Er schildert Größenwahn und Scham, abgerissene Autospiegel, Zwischenrufe auf Veranstaltungen, Klinikaufenthalte und Selbstmordversuche. Die drei Leben des Manikers, des Depressiven und des zwischenzeitlich Geheilten empfindet er als so unterschiedlich, dass sie für ihn nur in der Erinnerung zusammengehören. Das Gefühl, alle drei Thomas Melles seien derselbe, hat er nicht, so weit liegen die drei Leben auseinander. Viele Lesungen dieser Art, sagt er gegen Schluss des Abends, werde er nicht mehr bestreiten. Das Buch ins Schaufenster zu stellen hat ihm geholfen. Aber immer wieder hinzuzutreten ist anstrengend: "Ich muss etwas Neues machen." Ganz ohne Tarnung oder ihr Abwerfen.
FLORIAN BALKE
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main