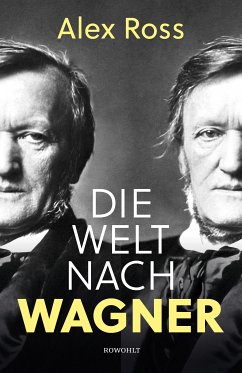Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Das Gesamtkunstwerk als Anstoß: Alex Ross beugt sich kundig über die Wirkungsgeschichte Richard Wagners und macht dabei durchaus noch Entdeckungen.
Als Richard Wagner am 13. Februar 1883 starb, war die Nachwelt mehr als nur respektvoll erschüttert. Nietzsche schrieb einem Freund: "Es war hart, sechs Jahre lang Gegner dessen sein zu müssen, den man am meisten verehrt hat." Brahms, hinter dem sich die Gegner Wagners versammelt hatten, schickte zur Beerdigung einen Lorbeerkranz. In Neuseeland schrieb ein Dichter namens Fergus Hume von der aischyleischen Musik des Verstorbenen, aus dem amerikanischen Süden meldete sich die Stimme eines Abolitionisten und Pazifisten, durch Wagner sei "die alte Ordnung unwirklich geworden". Die Totenfeiern zeigten, "welchen ungeheuren Schatten Wagner auf die Welt geworfen hatte", heißt es in "Die Welt nach Wagner. Ein deutscher Künstler und sein Einfluss auf die Moderne" von Alex Ross. Noch erstaunlicher aber ist, dass dieser Schatten mit dem Tod nicht verblasste. Die Einwände gegen Wagner - die Effektsicherheit, das Histrionentum - waren ja nicht aus der Luft gegriffen. Dass die Wirkung Wagners bald nachlasse, dass die Wagner'schen Effekte durch neue, stärkere entwertet würden, das war eine plausible Vermutung. Aber so kam es nicht. Im Gegenteil, Wagners Erfolg war nicht bloß einer der Opern- und Konzerthäuser, er zeigte sich am stärksten in der "beispiellosen Wirkung auf andere Künste". Sie vor allem interessiert Alex Ross, weniger die szenisch-musikalische Aufführungsgeschichte.
Die Wirkungsgeschichte Wagners ist nicht gerade unbekannt. Und doch gibt es, das eben gehört zur andauernden Wirkung, immer noch etwas Neues, Interessantes zu sagen, jedenfalls wenn man über einen freien, umsichtigen Kopf verfügt wie Alex Ross und dessen wunderbare Verbindung von Fleiß und Freude. Die große Linie gibt das Wort Nietzsches vor: "Wagner resümiert die Moderne." Es erklärt die besondere Bedeutung, die er für Frankreich hatte. Dort ist Wagner die Losung der Modernen, Wagner-Verachtung ist das Merkmal der Rückständigen. Flaubert schreibt im Wörterbuch der Gemeinplätze: "Lachen Sie, wenn Sie seinen Namen hören, und machen Sie sich über seine Musik der Zukunft lustig." Wagners Zusammenführung der Künste passt zu den synästhetischen Idealen der französischen Autoren; der freie Vers, das Prosagedicht zur "Emanzipation vom musikalischen Periodenschema", der "musikalischen Prosa" Wagners, wie der Musikwissenschaftler Carl Dahlhaus sie beschrieben hat. Diese Emanzipation lässt auch die großen französischen Maler - Manet, Monet, Seurat, Signac, van Gogh, Degas oder Cézanne - zu Parteigängern Wagners werden.
Anders, weniger streitig und weniger interessant, entwickelt sich das Wagner-Interesse in England. Hier ist der Komponist ein Bote nicht der Moderne, sondern aus der Welt des König Artus. Wie in Frankreich wird eine Zeitschrift der Wagnerianer gegründet, aber "The Meister" hat nicht das Niveau der "Revue Wagnérienne". Auch in den Vereinigten Staaten wird Wagner rasch populär, im Metropolitan Opera House ist er zeitweilig der meistgespielte Komponist und auch im Sommer in Brighton Beach auf Coney Island. Dass die "brutale Energie des amerikanischen Unternehmergeistes" (und das damit verbundene Bedürfnis nach Erbauung und Verfeinerung) sich besonders angesprochen fühlte, vermutet Alex Ross mit guten Gründen. Ähnlich hat schon Shaw die Popularität Shakespeares unter den britischen Manchesterkapitalisten erklärt.
Deutschland ist demgegenüber langweilig und verhockt. Für Nietzsches Vermutung, der Typus Wagner stehe "unter Deutschen einfach fremd, wunderlich, unverstanden, unverständlich da", findet Alex Ross einige weitere Gründe. Hier ist Wagner nicht ein Problem, hier ist er den einen nationaler Besitz, den anderen fremd, Thomas Mann ist eine der wenigen Ausnahmen. Das trübe Bild hat allerdings auch damit zu tun, dass Wagners Wirkung auf die Musik, auf Bruckner, Mahler, Strauss und die Neue Wiener Schule, von Ross kaum beachtet wird.
Ist schon die Wirkungsgeschichte Wagners im Kaiserreich matt und uninspiriert, so verstärkte sich das nach 1918. Hans Heinz Stuckenschmidt, Parteigänger der musikalischen Avantgarde, resümierte 1933: "Die Jugend aber, und merkwürdigerweise auch die Hitlerjugend, steht Wagner ferner als je. Sie fühlt sich in seinem Pathos nicht wohl. Sie versteht seine Sprache kaum." Und die kommenden zwölf Jahre änderten daran nichts. Wagner galt unter eingefleischten Nationalsozialisten nicht viel, als dekadent, "na - lassen wir halt dem Führer seinen Spleen". In der Saison 1932/33 kam es im Reich zu 1837 Wagner-Aufführungen, 1939/40 waren es nur noch 1154. Wagner war unmodern, kompliziert, volksfern. Auch die oft gehörte Behauptung, in den KZs sei Wagner gespielt worden, ist nicht gut belegt. "Wir haben ganz sicher keinen Wagner gespielt", sagte später Anita Lasker-Wallfisch, Mitglied im Frauenorchester von Auschwitz und professionelle Cellistin. Wagner war zu schwierig für ein Ensemble mit vielen Laien, stattdessen gab es Schlager, Walzer, einzelne Sätze von Schubert und Beethoven.
Auf dem Gang durch die Kulturgeschichte, den der Leser mit Alex Ross unternimmt, trifft er natürlich alte Bekannte, aber es gibt doch sehr viel Überraschendes. Für Theodor Herzl war Wagner die große Stärkung in allen Krisen. Er sah sich als der zweite Moses seines Volkes, seine Staatsgründung als Werk ungekannter Größe: "Moses Auszug verhält sich dazu wie ein Fastnachtspiel von Hans Sachs zu einer Wagnerschen Oper." Die russische Revolution feierte sich mit Massenspektakeln, darunter "Das Geheimnis der befreiten Arbeit": Musik aus "Lohengrin" verkündete "die Ankunft des Königreichs der Freiheit". Die musikalische Leitung hatte Dimitri Tiomkin, den man als einen der wichtigsten Komponisten Hollywoods kennt. Großartig auch die Anverwandlung Wagners im Jazz (Proben auf Youtube unter Daniel Lambert, Pilgrim Chorus oder Charlie Parker, Cool Blues, Boston Storyville 1953).
"Lohengrin" geriet in Deutschland unter Verdacht. Der Held aus mythischer Ferne, der sich nicht befragen lassen will, hat etwas vom Führer. Für W. E. B. Du Bois sah die Sache anders aus. "The Souls of Black Folk", ein Grundlagenbuch der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung, enthält ein erzählendes Kapitel: Ein junger Schwarzer verlässt seine Heimat, in New York besucht er offenbar zum ersten Mal ein Konzert mit klassischer Musik, er hört das "Lohengrin"-Vorspiel und fühlt die Sehnsucht, "sich mit dieser klaren Musik aus dem Schmutz und Staub des niederen Lebens zu erheben. Wenn er nur in der freien Luft aufleben könnte, wo Vögel singen und untergehende Sonnen von Blut unberührt sind." In dieser Luft darf er nicht leben, schon bald wird er Opfer eines Lynchmobs. Er weiß es, und während er auf seine Mörder wartet, wird er ruhig, lächelt und erinnert er sich an "Lohengrin", den Augenblick seines Lebens, "in dem der Schleier sich zu lüften schien".
Das hat mit Wagner zu tun, gewiss, aber auch mit einer Kraft der Kunst, die heute kaum mehr erfahren wird. Künstler, die in unseren Tagen sterben, hinterlassen nur noch eine respektvoll erschütterte Öffentlichkeit. Als Hans Heinz Stuckenschmidt 1933 über Wagners sinkende Bedeutung nachdachte, mochte er das schon im Blick gehabt haben: "Vielleicht ist wirklich Kunst nur noch ein Rudiment früherer Kultur, wie der Schwanzknochen am menschlichen Leibe."
STEPHAN SPEICHER
Alex Ross: "Die Welt nach Wagner". Ein deutscher Künstler und sein Einfluss auf die Moderne.
Aus dem Englischen von Gloria Buschor und Günter Kotzor. Rowohlt Verlag, Hamburg 2020. 908 S., Abb., geb., 40,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main