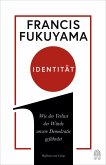In der Debatte über den Aufstieg nationalistischer und illiberaler Parteien ist ein altes Gespenst wieder aufgetaucht - das Gespenst der liberalen Kosmopoliten: gut ausgebildete, international vernetzte Wissenschaftlerinnen, Journalisten oder Politikerinnen, die sich gegenseitig ihrer moralischen Überlegenheit versichern. Die Kluft zwischen Kosmopolitinnen und heimatverbundenen Kommunitaristen gilt als einer der zentralen Konflikte unserer Zeit.
Eine zutreffende Diagnose? Oder ist die Vorstellung von entwurzelten liberalen Eliten bloß ein Zerrbild? Der Psychoanalytiker und Publizist Carlo Strenger kennt diese Gruppe nur allzu gut: weil er selbst zu ihr gehört - und aus dem Alltag seiner therapeutischen Praxis. Anhand einschlägiger soziologischer Literatur verallgemeinert er seine Befunde. Ja, so die selbstkritische Einsicht, die liberalen Eliten sind oft zu arrogant. Und dennoch brauchen wir ihre Expertise. Strenger schließt mit einem doppelten Plädoyer: für mehr Bodenständigkeit unter den liberalen Kosmopolitinnen und eine liberal-kosmopolitische Grundausbildung für alle.
Eine zutreffende Diagnose? Oder ist die Vorstellung von entwurzelten liberalen Eliten bloß ein Zerrbild? Der Psychoanalytiker und Publizist Carlo Strenger kennt diese Gruppe nur allzu gut: weil er selbst zu ihr gehört - und aus dem Alltag seiner therapeutischen Praxis. Anhand einschlägiger soziologischer Literatur verallgemeinert er seine Befunde. Ja, so die selbstkritische Einsicht, die liberalen Eliten sind oft zu arrogant. Und dennoch brauchen wir ihre Expertise. Strenger schließt mit einem doppelten Plädoyer: für mehr Bodenständigkeit unter den liberalen Kosmopolitinnen und eine liberal-kosmopolitische Grundausbildung für alle.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.

Nur nicht so herablassend: Carlo Strenger liest den liberalen Eliten die Leviten
Vor kurzem meinte der amerikanische Sozialphilosoph Michael Walzer in einem Interview, "dass die Motivation vieler Trump-Unterstützer weniger ökonomisch grundiert ist als durch Verbitterung darüber, von den Liberalen als Hinterwäldler behandelt zu werden" (F.A.Z. vom 6. Juni). Wer das Gleiche aus einer authentischen Quelle erfahren will, kann es in der "Hillbilly-Elegie" von J. D. Vance nachlesen, dem Buch eines Autors, der es als Investmentbanker "geschafft" hat, aber seinem Herkunfts-Milieu in Zuneigung verbunden blieb.
Carlo Strenger, Psychotherapeut und Kolumnist der liberalen israelischen Tageszeitung "Haaretz", teilt Walzers und Vances Einschätzung: Weil die liberalen Kosmopoliten "all jene verächtlich gemacht (haben), die anderer Meinung sind, und sie als dumm, indoktriniert und obrigkeitshörig" ansehen, hätten sie deren "Sympathien und Wählerstimmen verspielt". In seinem Buch versucht er zu zeigen, wer diese "verdammten liberalen Eliten" sind und warum sie dennoch gebraucht werden.
Strenger hält sich dabei weitgehend an die inzwischen fast kanonisierte Unterscheidung zwischen "Anywheres" und "Somewheres". Erstere, ein Viertel bis ein Drittel der Bevölkerung in der westlichen Welt, sind die gut ausgebildeten Gewinner der Globalisierung, zu denen sich Strenger selbst zählt. Sie sind pro-europäisch eingestellt, gegen Nationalismus und für offene Grenzen. Die ortsgebundenen "Somewheres" dagegen identifizieren sich nolens volens mit Lebensstil und Kultur ihrer Herkunftsregion; tätig sind sie meist im niedrig qualifizierten Dienstleistungssektor, oft sind ihre Jobs durch Globalisierungsfolgen wie etwa die Migration gefährdet.
Allerdings behauptet Strenger, dass auch bei den "Anywheres" nicht alles Gold sei, was glänzt. Diese Eliten seien leistungsfixiert und harter Konkurrenz in einem Milieu und in Branchen ausgesetzt, die sich schnell verändern. Da sie aus ihrer Herkunftswelt ausgezogen seien, lockerten sich alte Bindungen zunehmend, wegen ihrer Ortlosigkeit falle es ihnen schwer, neue stabile Bindungen aufzubauen.
Um das zu illustrieren, schildert Strenger fünf Fälle aus seiner psychotherapeutischen Praxis, ein Kapitel, das mehr als ein Drittel des Buches füllt. Dabei kommen allerdings individuelle Traumata und Neurosen zutage, die weniger mit der Globalisierung als mit persönlichen Konflikten zu tun haben - beispielsweise dem Problem eines gläubigen Katholiken mit seiner Homosexualität. Andere Lebensprobleme sind von jeher typisch für Geschichten von Aufsteigern, die sich ihrer Familie oder Klasse, ihrer Heimat oder alten Überzeugungen entfremdet haben. Man fragt sich, ob die Erfahrungswelt eines Psychotherapeuten da nicht ein schiefes Bild gibt, da er es mehr mit den problembeladenen "Anywheres" zu tun hat als mit den Glückspilzen unter ihnen.
Weil die "Anywheres" nicht nur die kreativen Leistungsträger der modernen Welt, sondern auch Verteidiger der "offenen Gesellschaft" sind, baut Strenger dennoch auf sie im Kampf gegen rechte Populisten à la Trump. Was er dieser Elite vorwirft, ist, dass sie das Bedürfnis der "Somewheres" nach Identität nicht verstehe, einen "Mangel an Empathie und Verständnis" für deren Verbundenheit mit lokalen, lang etablierten Traditionen aufweise, und darüber hinaus die "Neigung", jene, "die ihre aufgeklärten Ansichten nicht teilen, geringzuschätzen und runterzumachen".
Strenger sieht wohl, dass die Unterscheidung zwischen Populisten wie Trump oder Orbán und ihren mehr oder weniger berechtigte Zukunftssorgen hegenden Wählern zwar richtig ist, aber nicht weit führt: Wenn die Anführer attackiert werden, fühlen sich auch ihre Anhänger angegriffen. Was also ist zu tun? Ändern lassen sich tief eingefressene Ressentiments nicht so schnell. Dennoch empfiehlt er, weniger herablassend und arrogant zu sein; die Lügen der Anführer durch eigenes Fachwissen zu widerlegen; Probleme, die es wirklich gibt, nicht zu verniedlichen, etwa bei der Integration kulturfremder Migranten. Zweifellos ist das alles richtig, und diese Rezepte werden ja angewandt; durchschlagenden Erfolg haben sie bisher allerdings nicht gehabt - siehe Wahlergebnisse in Europa und Amerika.
Auch Strengers Aufruf, "die größtmöglichen Anstrengungen (zu) unternehmen, damit die Bevölkerungsmehrheit die Bürgertugenden und Kenntnisse erwirbt, die notwendig sind, um politischen Argumentationen folgen und ihre Stichhaltigkeit einschätzen zu können", wirkt im Zeitalter von "fake news" und Shitstorms etwas altbacken. Strenger selbst spricht am Ende seines Buches ein wenig resigniert von der Hoffnung, dass "das Pendel ... wieder zurückschwingt", freilich ohne zu wissen, wann das sein wird.
GÜNTHER NONNENMACHER
Carlo Strenger:
"Diese verdammten
liberalen Eliten". Wer sie sind und warum wir sie brauchen.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2019. 172 S., geb., 16,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Eine anschauliche Ergänzung [soziologischer Gegenwartsdiagnosen] bietet Carlo Strengers kleine Brandschrift über die verdammten liberalen Eliten.« Gustav Seibt Süddeutsche Zeitung 20190702