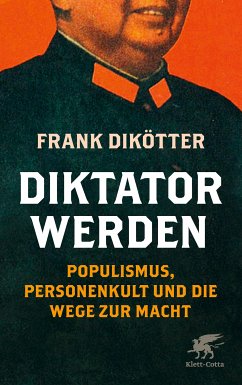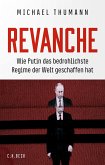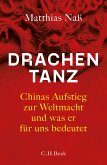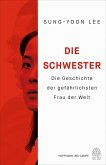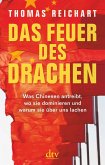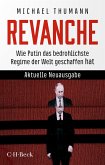Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Wie man Personenkult inszeniert: Frank Dikötter schreibt Porträts von Diktatoren des vorigen Jahrhunderts.
Nach 1989/90 konnte man den Eindruck haben, Aufstieg und Fall von Diktatoren seien nur noch von historischem Interesse. Das galt nicht nur für den zusammenbrechenden Ostblock, sondern auch im Hinblick auf die "Dritte Welt", wo Westen wie Osten vormals eine ansehnliche Zahl von Diktatoren als Garanten für geopolitischen Einfluss unterstützt hatten. Mit dem Ende des Ost-West-Konflikts verschwanden die meisten von ihnen sang- und klanglos von der politischen Bühne: Auf sich allein gestellt, hatten sie sich nicht an der Macht halten können.
Dass die Geschichte der Diktatoren und ihrer Herrschaftspraktiken wieder zum Thema geworden ist, hat nicht zuletzt mit dem Aufstieg autokratischer Politiker in aller Welt zu tun und der naheliegenden Frage, ob wir für den Umgang mit ihnen aus der Geschichte lernen können. Auch wenn Frank Dikötter sich ausnahmslos mit Diktatoren beschäftigt, die längst tot sind - sei es von ihren Gegnern exekutiert, durch Selbstmord geendet oder eines natürlichen Todes gestorben -, so ist sein Interesse an ihnen, wie das Nachwort zeigt, doch durch die Gegenwart bestimmt, wo von Kim Jong-un und Baschar al Assad, von Erdogan und Xi Jinping die Rede ist, und die Assoziation zu weiteren ist naheliegend. Der Titel der deutschen Ausgabe sucht diese Assoziationen zu befeuern, indem er den im Original fehlenden Begriff des Populismus hinzufügt: Was vergangen schien, ist wieder gegenwärtig. Die Einmannherrschaft ist zurückgekehrt, und in den liberalen Demokratien muss man sich darüber Gedanken machen, wie man mit diesen Männern - es handelt sich nur um Männer - umgehen will.
Nun sind Diktatoren einander nicht gleich, und ein allgemeines Strukturmuster ihres Aufstiegs und Falls lässt sich kaum entwickeln. Es gab im zwanzigsten Jahrhundert faschistische Diktatoren, die daran scheiterten, dass sie die von ihnen begonnenen Kriege verloren; es gab kommunistische Diktatoren, die sich gänzlich anderen Risiken bei der Aufrechterhaltung ihrer Herrschaft ausgesetzt sahen; und es gab Diktatoren, deren Aufstieg mit dem Ende der europäischen Kolonialherrschaft begann und die ihre Macht auf ethnische Loyalitäten und familiale Bindungen stützten. Was ist ihnen gemeinsam? Was lässt sich aus der Beschäftigung mit ihren "Karrieren" für die Gegenwart lernen? Viel hängt hier an der Auswahl der zu beschreibenden Diktatoren, und zwar umso mehr, wenn man sich ihnen über die Biographie und nicht über den strukturierten Vergleich ihres Aufstiegs und ihrer Behauptung an der Macht nähert.
Dikötter hat acht Diktatoren ausgewählt: Mussolini und Hitler als Vertreter des faschistischen Typs, Stalin, Mao Tsetung, Kim Il-sung und Ceausescu für den kommunistischen Typ sowie François Duvalier (Papa Doc) aus Haiti und Mengistu aus Äthiopien als Vertreter des Diktatorenmodells der Dritten Welt. Über die für diese Wahl maßgeblichen Kriterien äußert er sich nicht; sie dürften von der Vorstellung angeleitet sein, nach Möglichkeit alle Regionen in den Blick zu bekommen. Dennoch dominiert Europa, während Lateinamerika, Afrika und Südostasien unterrepräsentiert sind. Faschistische Diktatoren, die "im Bett" gestorben sind, wie Franco und Salazar, kommen nicht vor, und die jeweiligen Rahmenbedingungen, die der Entstehung einer Diktatur entgegenkamen, werden nur am Rande gestreift. Insgesamt interessiert sich Dikötter mehr für die Zeit des Aufstiegs als die des Niedergangs in den Karrieren. Im Prinzip handelt es sich um acht nebeneinander gestellte Biographien, bei denen der Personenkult im Zentrum steht. Wie haben sich Diktatoren bei den Massen populär gemacht, und auf welche Medien haben sie dabei gesetzt?
Es fällt auf, dass die meisten dem Medium Buch eine große Bedeutung beimaßen, wenngleich auch der Rundfunk als Massenmedium eine große Rolle spielte. Dennoch hat man bei der Lektüre von Dikötters Buch den Eindruck, dass der Rundfunk (das Fernsehen spielt noch keine Rolle) nur der Platzhalter des persönlichen Auftritts ist, weil der Betreffende nicht überall sein kann. Beide, das Buch, in dem die Grundzüge einer mit dem Diktator verbundenen Ideologie präsentiert werden, und der sorgfältig inszenierte Auftritt vor jubelnden Massen, legen freilich nahe, dass wir es hier mit den Diktatoren einer medialen Vergangenheit zu tun haben. Außerdem hat die Stilisierung Stalins zum "größten Wissenschaftler" des zwanzigsten Jahrhunderts sowie Maos kleines "Rotes Buch" für die Perpetuierung ihrer Herrschaft eine wesentlich andere Bedeutung gehabt als etwa Hitlers "Mein Kampf"; und die "Werke" des großen Conducators Ceausescu haben eher skurrilen Charakter, für seinen langen Verbleib an der Macht sind sie eher marginal.
Auch sonst fallen eine Reihe von Unterschieden auf: Mussolini und Hitler schlugen die Massen mit ihren Reden in Bann. Das mag auch noch für Lenin gelten, nicht jedoch für Stalin, der die großen Paraden schweigend abnahm, und auch Mao Tsetung beherrschte China mehr durch Direktiven als durch persönliche Auftritte. Charismatische Herrschaft, die häufig mit diktatorischer Macht verbunden wird, kann sehr unterschiedliche Grundlagen haben: Gründete sie sich bei Mussolini und Hitler auf rhetorische Präsenz, so war sie bei Duvalier mit der Vorstellung verbunden, er verfüge über magische Fähigkeiten und könne seine Gegner verhexen. Bei Stalin und Mao lässt sich so etwas wie die Magie öffentlicher Absenz beobachten, während Kim Il-sung Nordkorea bereits zu Lebzeiten mit Statuen zupflastern ließ, um den Eindruck von Omnipräsenz zu erzeugen. Das alles kann man bei Dikötter nachlesen; über die Bedeutung dessen für den Typ diktatorischer Herrschaft hat er sich jedoch ebenso wenig Gedanken gemacht wie darüber, ob diese Unterschiede nun in der Person des jeweiligen Diktators oder in der Kultur seines Landes begründet sind.
Eines zumindest ist allen behandelten Figuren gemeinsam: das grenzenlose Misstrauen, mit dem sie ihrer Umgebung begegnen, und die Neigung, niemandem über längere Zeit einen festen Platz in ihrer engeren Umgebung zuzugestehen. Tyrannen, so bereits der Tenor von Xenophons Dialog "Hieron", einem Text des vierten vorchristlichen Jahrhunderts, haben keine Freunde und führen deswegen letztlich ein erbärmliches Leben. Diese antike Einsicht lässt sich an den von Dikötter dargestellten Diktatoren bestätigen. Prunk und Pomp, mit dem sie sich umgeben, sind ebenso wie die von einigen zur Schau gestellte Bescheidenheit Bestandteil des Personenkults, aber kaum eine Befriedigung persönlicher Präferenzen. Es ist nicht sonderlich attraktiv, Diktator oder Tyrann zu werden, lautet denn auch Dikötters Resümee.
HERFRIED MÜNKLER
Frank Dikötter: "Diktator werden". Populismus,
Personenkult und die Wege zur Macht.
Aus dem Englischen von Henning Dedekind und Heike Schlatterer. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2020. 366 S., geb., 26,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main