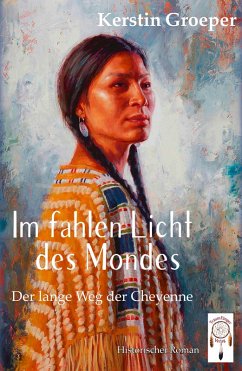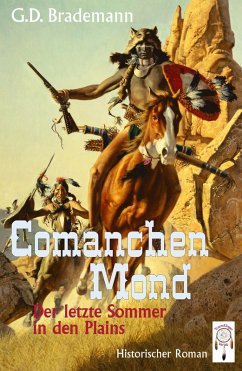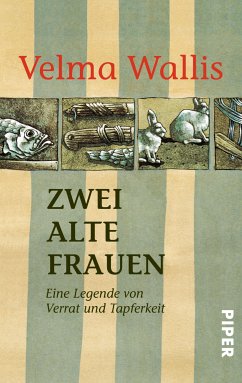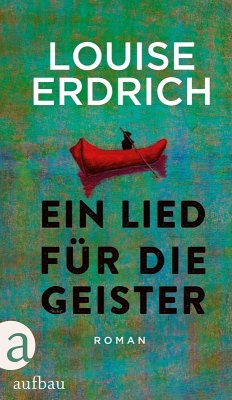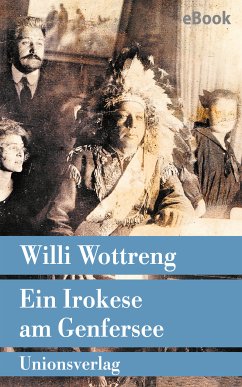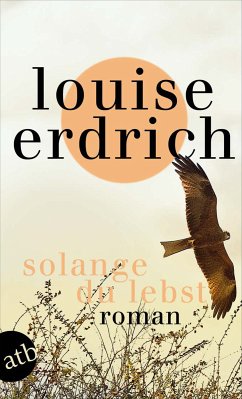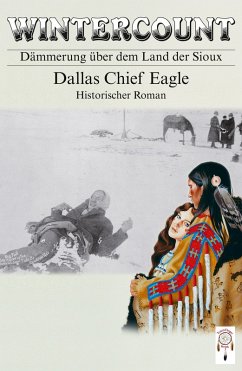Tommy Orange
eBook, ePUB
Dort dort (eBook, ePUB)
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 22,00 €**
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!






Tommy Orange gibt mit seinem vielbesprochenen Bestseller "Dort, Dort" Native Americans eine Stimme. "Eine neue Art amerikanisches Epos." (New York Times) Jacquie ist endlich nüchtern und will zu der Familie zurückkehren, die sie vor vielen Jahren verlassen hat. Dene sammelt mit einer alten Kamera Geschichten indianischen Lebens. Und Orvil will zum ersten Mal den Tanz der Vorfahren tanzen. Ihre Leben sind miteinander verwoben, und sie sind zum großen Powwow in Oakland gekommen, um ihre Traditionen zu feiern. Doch auch Tony ist dort, und Tony ist mit dunklen Absichten gekommen. "Dort dort" is...
Tommy Orange gibt mit seinem vielbesprochenen Bestseller "Dort, Dort" Native Americans eine Stimme. "Eine neue Art amerikanisches Epos." (New York Times) Jacquie ist endlich nüchtern und will zu der Familie zurückkehren, die sie vor vielen Jahren verlassen hat. Dene sammelt mit einer alten Kamera Geschichten indianischen Lebens. Und Orvil will zum ersten Mal den Tanz der Vorfahren tanzen. Ihre Leben sind miteinander verwoben, und sie sind zum großen Powwow in Oakland gekommen, um ihre Traditionen zu feiern. Doch auch Tony ist dort, und Tony ist mit dunklen Absichten gekommen. "Dort dort" ist ein bahnbrechender Roman, der die Geschichte der Native Americans neu erzählt und ein Netz aufwühlend realer Figuren aufspannt, die alle an einem schicksalhaften Tag aufeinandertreffen. Man liest ihn gebannt von seiner Wucht und seiner Schönheit, bis hin zum unerbittlichen Finale.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, L ausgeliefert werden.
- Geräte: eReader
- ohne Kopierschutz
- eBook Hilfe
- Größe: 2.16MB
- FamilySharing(5)
- Text-to-Speech
- Keine oder unzureichende Informationen zur Barrierefreiheit
Tommy Orange, geboren 1982 in Oakland, ist Mitglied der Cheyenne und Arapaho Tribes. Sein erstes Buch, Dort, dort, war für den Pulitzerpreis 2019 nominiert und erhielt den American Book Award 2019. Er lebt mit seiner Frau und seinem Sohn in Angels Camp, Kalifornien.
Produktdetails
- Verlag: Hanser Berlin
- Seitenzahl: 288
- Erscheinungstermin: 19. August 2019
- Deutsch
- ISBN-13: 9783446265462
- Artikelnr.: 56890334
 buecher-magazin.deWenn es dort kein dort mehr gibt, wie entkommt die Identität dann dem kollektiven Trauma? Zwölf Menschen werden am Anfang vorgestellt mit Name und Herkunft. Sie alle sind Native Americans und leben im Oakland des 21. Jahrhunderts. Tommy Orange, selbst Mitglied der Cheyenne and Arapaho Tribes, ist ein tollkühner Erzähler. Er wirft uns hinein in rasant geschnittene Momentaufnahmen dieser allesamt versehrten Menschen und schafft es doch, jede Figur mit einem ganz eigenen Sound zu versehen. Da ist der 21-jährige Tony, der sein angeborenes fetales Alkoholsyndrom Drome nennt und für Octavio mit Drogen dealt. Opal, die für ihre Schwester Jacquie Red Feather deren drei Enkel aufzieht. Davon der 14-jährige Orvil, der den Tanz seiner Vorfahren mit YouTube trainiert. Dene, der in seinem ersten Dokumentarfilmprojekt die Geschichten von Native Americans aus Oakland aufzeichnet. Blue, die das Powwow-Komitee leitet, unterstützt vom jungen Edwin, der seinen indianischen Vater sucht. „Bleiben“, „Heimkehren“, „Zurückfordern“ heißen die drei Buchteile, die alle auf das große Finale, den Big Oakland Powwow hinführen. Hier fließen ihre löchrigen und kaputten Lebensläufe zusammen, doch nicht alle kommen wie Dene oder Orvil, um die Traditionen ihrer Vorfahren zu feiern.
buecher-magazin.deWenn es dort kein dort mehr gibt, wie entkommt die Identität dann dem kollektiven Trauma? Zwölf Menschen werden am Anfang vorgestellt mit Name und Herkunft. Sie alle sind Native Americans und leben im Oakland des 21. Jahrhunderts. Tommy Orange, selbst Mitglied der Cheyenne and Arapaho Tribes, ist ein tollkühner Erzähler. Er wirft uns hinein in rasant geschnittene Momentaufnahmen dieser allesamt versehrten Menschen und schafft es doch, jede Figur mit einem ganz eigenen Sound zu versehen. Da ist der 21-jährige Tony, der sein angeborenes fetales Alkoholsyndrom Drome nennt und für Octavio mit Drogen dealt. Opal, die für ihre Schwester Jacquie Red Feather deren drei Enkel aufzieht. Davon der 14-jährige Orvil, der den Tanz seiner Vorfahren mit YouTube trainiert. Dene, der in seinem ersten Dokumentarfilmprojekt die Geschichten von Native Americans aus Oakland aufzeichnet. Blue, die das Powwow-Komitee leitet, unterstützt vom jungen Edwin, der seinen indianischen Vater sucht. „Bleiben“, „Heimkehren“, „Zurückfordern“ heißen die drei Buchteile, die alle auf das große Finale, den Big Oakland Powwow hinführen. Hier fließen ihre löchrigen und kaputten Lebensläufe zusammen, doch nicht alle kommen wie Dene oder Orvil, um die Traditionen ihrer Vorfahren zu feiern.© BÜCHERmagazin, Tina Schraml (ts)
Perlentaucher-Notiz zur Dlf-Rezension
Dieser Roman bietet keine Wohlfühllektüre, warnt Rezensent Eberhard Falcke. Tommy Orange erzählt in seinem grandiosen Debütroman vom Alltag der assimilierten Ureinwohner Amerikas und von ihrer brutalen Vergangenheit. Dabei gelingt es ihm, stets die Waage zu halten zwischen "sozialkritischer Anklage und nüchterner Bestandsaufnahme", zwischen Elend und Stolz seiner Figuren, zwischen Erzählung und Essay, so Falcke. Der Autor, der sich selbst den Chayenne und Arapaho-Stämmen zugehörig fühlt, hüte sich jedoch davor, seine Figuren als mitleiderregende Vertreter eines gemeinsamen Schicksals zu porträtieren. Stattdessen zeigt er sie als individuelle und facettenreiche Menschen, die sich ein möglichst gutes Leben zu erkämpfen versuchen, lobt Falcke, der "Dort dort" so differenzierend wie spannend findet.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Tommy Oranges so packender wie herzzerreißender Roman war eine literarische Sensation des Jahres 2018. Das liegt daran, dass Orange den Leser auf hypnotische Weise hineinzieht in die Welt heutiger urbaner Indianer (in Oakland) - und ihre diffizilen Identitätsverwirrungen. ... Dabei ist 'Dort dort' aber streckenweise auch ein recht witziges Buch und die Wut, die dahinter steckt, gibt ihm eine drängende Energie." Christina Böck, Wiener Zeitung, 04.09.22 "Wie anders geht dieses Buch mit den Generationen um, die es umfasst: respektvoll und deshalb bereit, auf ein sauberes Happy End zu verzichten. Es blickt tief hinein ins indianische Bewusstsein." Cornelius Dieckmann, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 01.10.19 "Ein ungemein fesselnded,
Mehr anzeigen
bitterböses, auch witziges, dann plötzlich poetisch ausgreifendes Buch (von Hannes Meyer sehr überzeugend ins Deutsche gebracht) nie dick, pathetisch oder zeigefingerisch. Vielmehr knapp, rau, ja, grob und in einer Weise ansteckend ingrimmig sogar im Komischen, dass jedes Lachen rasch abreißt und im Halse stecken bleibt." Harald Eggebrecht, Süddeutsche Zeitung, 26.09.19 "'Dort, Dort' ist ein sehr politischer Roman, der die traumatischen Folgen der weißen Landnahme Amerikas bis in die Gegenwart behandelt. Orange erzählt vom realen Leben einer Community in und um Oakland und reibt sich an den Bildern der Massenkultur." Jutta Sommerbauer, Die Presse, 22.09.19 "Tommy Oranges Debütroman ... ist wohl nicht nur das härteste Stück Native American Literature, das je geschrieben wurde, sondern bringt selbst weiße Leser, die wenig über die Situation der indigenen Völker Amerikas wissen, mit großer Wut und Dringlichkeit auf den Stand der Dinge, dass es wehtut." Susanne Messmer, taz, 12.09.19 "Identitätspolitik, politische Korrektheit: Angesichts mancher Kapriolen, die in den USA im Namen dieser Begriffe vollführt werden, kann man sich tatsächlich nur an den Kopf greifen. Aber dann kommt plötzlich ein Buch, das die Identitätsfrage von der universitären Spielwiese wegfegt und mit neuer Dringlichkeit verhandelt." Angela Schrader, Neue Zürcher Zeitung, 10.09.19 "'Dort, Dort' spricht die Sprache der Straße und verfügt über lyrische Kraft, ohne in Pathos zu verfallen." Sebastian Fasthuber, Falter, 06.09.19 "Das 'Wir' wird in 'Dort Dort' nun zu zwölf Stimmen, individuellen aus unterschiedlichen Lebenssituationen, in unterschiedlichem Alter, unterschiedlich gebildet. Orange und sein Übersetzer Hannes Meyer wissen das in feiner Abstufung darzustellen, sowohl mit Blick auf die Sprache als auch auf die Selbstreflexion (und wie sehr kann es literarisch missglücken, das Projekt Vielstimmigkeit, hier aber nicht)." Judith von Sternburg, Frankfurter Rundschau, 20.08.19 "Orange entwirft Figuren in einer Mischung aus Brutalität und Naivität, aus Drogenrausch und Zärtlichkeitssehnsucht, aus Hoffnung und Schicksal. Mit sensibler Courage gelingt es ihm, ein Bild zu zeichnen, das weder in die Falle des Gegenklischees tappt noch in den alten verzerrten Einseitigkeiten stecken bleibt." Gabriele von Arnim, Deutschlandfunk Kultur, 24.08.19 "Es ist dieses Nebeneinander an Stimmen, das Orange Buch so stark macht: Weil es nie genug Geschichten geben kann, um dem rassistischen Stereotyp der homogenen Masse etwas entgegenzusetzen." Anne Haemig, Spiegel Online, 20.08.19 "Über Glanz und Elend, Fluch und Notwendigkeit, Konstruktion und Verhängnis von Identität - und damit über eines der ganz großen Themen einer Gegenwart, die ihre schmerzhaft empfundene Leere allzu gern mit einer oft höchstens erahnten Vergangenheit füllt." Wieland Freund, Welt am Sonntag, 18.08.19 "Der überfällige Roman über Indianer, die in Städten leben. Ein Chor, erstmals hörbar." Peter Pisa, Kurier, 17.08.19
Schließen
Kein leichter Stoff, doch voller literarischer Wucht und heiligem Zorn. Ferien-Brigitte, Sommer 2021
Ist es eine Tatsache, dass der Ursprung von Thanksgiving wirklich so ist, wie es die Amerikaner uns berichten? Also, dass die Einwanderer friedlich mit den Ureinwohnern zusammensaßen und Speise und Trank genießen konnten? Und wie geht es den Nachkommen der Natives heute? Was spielt sich …
Mehr
Ist es eine Tatsache, dass der Ursprung von Thanksgiving wirklich so ist, wie es die Amerikaner uns berichten? Also, dass die Einwanderer friedlich mit den Ureinwohnern zusammensaßen und Speise und Trank genießen konnten? Und wie geht es den Nachkommen der Natives heute? Was spielt sich in den Reservaten ab? Warum suchen viele von ihnen Trost im Alkohol und anderen Drogen? Das sind Fragen, die ich mir immer mal wieder stelle und aus dem Grund lese ich Bücher zu diesen Themen.
Dort, dort ist ein ganz besonderes Buch. Tommy Orange gehört selbst zu den Nachkommen der Natives und wer, wenn nicht er, kann authentisch über ihr Leben berichten. Er schreibt in dem Buch über die Probleme der Indianer, die nicht nur vom Rassismus der „Weißen“ geprägt sind. Bis heute werden sie diffamiert und häufig wie Ausstellungsstücke missbraucht. Sie sollen sich mit den Kostümen ihrer Vorväter schmücken und so wie sie tanzen. Alles zur Belustigung und Zeitvertreib der „Weißen“. Aber hin und wieder dürfen sie sich auch mit ihresgleichen treffen. Das Powwow in Oakland. Hier dürfen sie so sein, wie es ihnen gefällt. Die Akteure in dem Buch Dort, dort fiebern diesem Ereignis entgegen. Besonders die jungen Leute freuen sich darauf. Doch, wird ihre Hoffnung erfüllt und haben sie tatsächlich nur Freude an dem Tag?
Tommy Orange beschreibt das Leben von unterschiedlichen Charakteren, die alle eins gemeinsam haben. Sie sind „Natives“. Das bedeutet auch, dass sie vor vielen Jahren von den Eindringlingen im wahrsten Sinne des Wortes überrannt wurden. Ihnen wurde die Existenz geraubt, nie gekannte Krankheiten ins Land geschleppt und sie waren nur noch Menschen zweiter Klasse. Dass das wohl nie endet, davon bin ich überzeugt. Und dass hier das Problem vieler „Indianer“ liegt, ist wohl jedem klar. Zumal sich ihr Dasein unter Präsidenten wie dem jetzigen keinesfalls zum Guten wendet. Auch er vergisst, was seine Vorfahren den Ureinwohnern antaten und diese keinerlei Recht für ihr Vorgehen hatten.
Ich las nicht das Buch, sondern hörte es mir an. Es wird von Christian Brückner gelesen. Für mich war es ein Hochgenuss, diese markante Stimme über 550 Minuten zu hören. Er entführte mich eindrucksvoll in die Lebenssituation der Natives und ja, ich litt mit ihnen mit. Also ist es selbstverständlich, dass ich fünf Sterne plus und eine Hör- oder Leseempfehlung gebe.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Jacquie ist endlich clean...kein einfacher Weg. Nun will sie ihre Familie wiedersehen. Ihre Familie ist eine ganz besondere, aber das weiß sie. Sie sind anders. Dene liebt es zu fotografieren und Orvil traut sich endlich an den Tanz seiner Vorfahren heran. Das „Powwow“ in Oakland …
Mehr
Jacquie ist endlich clean...kein einfacher Weg. Nun will sie ihre Familie wiedersehen. Ihre Familie ist eine ganz besondere, aber das weiß sie. Sie sind anders. Dene liebt es zu fotografieren und Orvil traut sich endlich an den Tanz seiner Vorfahren heran. Das „Powwow“ in Oakland wird sie wieder alle vereinen, denn es ist ihre Tradition. Aber leider wird auch der dunkle Toni dort zugegen sein....Toni mit den dunklen Absichten...keine gute Voraussetzung für so ein Fest.
Ja, es gibt sie wirklich, die Native Americans. Viele sprechen nicht von ihnen, andere haben sie aus den eigenen Vorstellungen gestrichen, andere respektieren sie, andere dulden sie - kein einfaches Leben also. Autor Tommy Orange hat sich in diesem Roman diesem Volk verschrieben und hat mit seinen Protagonisten einen bedeuteten Roman verfasst. Seine Figuren sind laut und schrill, leise und schüchtern, bunt und schwarz-weiß und genauso ist die gesamte Geschichte - kurz: einfach nur aufwühlend und das Wichtigste dazu, sie sind real. Sein Schreibstil ist recht eigen und man muss schon etwas Lust mitbringen und sich auf ihn einlassen. Hat man das ein Mal getan, eröffnet sich eine sehr bewegende und riskante Story die einen fesselt bis zum Schluss. Wie bereits erwähnt, sind seine Protagonisten etwas besonderes: sie sind die „Ureinwohner“ die den Fleck, hier Oakland, in dem die Geschichte spielt, zu dem Land gemacht haben...hier geht es um Ahnen, Tradition, Wut, Gerechtigkeit, ein verhasstes Menschenbild und die Sichtweise aus allen Seiten. „Dort dort“....es gibt kein dort?! Oder doch? Wo ist es? Für wem, für was? Wem gehört es?
Ein sehr spannender und an manchen Stellen harter Roman mit einer besonderen Seite. Ich mochte Oranges Schreibstil sehr und bereue keine Leseminute! 4 von 5 Sterne dafür!
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für