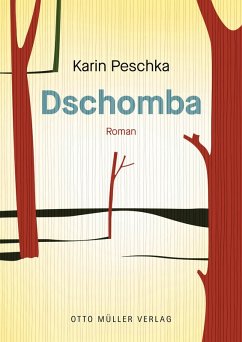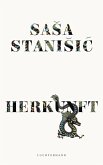Ein Fremder, der doch irgendwie dazugehört
1954, das kleine Dorf Eferding, irgendwo in Oberöstereich, hier geht alles seinen Gang. Es ist da, was man zum Leben braucht, Gasthöfe, Kirche, Dechant und der Friedhof natürlich. Eines Tages gibt es Neuigkeiten. Ein junger Serbe, Dschomba, tanzt
halbnackt über den Friedhof, dort 'wo die Serben liegen', auf der Suche nach dem in Kriegszeiten…mehrEin Fremder, der doch irgendwie dazugehört
1954, das kleine Dorf Eferding, irgendwo in Oberöstereich, hier geht alles seinen Gang. Es ist da, was man zum Leben braucht, Gasthöfe, Kirche, Dechant und der Friedhof natürlich. Eines Tages gibt es Neuigkeiten. Ein junger Serbe, Dschomba, tanzt halbnackt über den Friedhof, dort 'wo die Serben liegen', auf der Suche nach dem in Kriegszeiten verschollenen Bruder. Der Dechant nimmt sich seiner an, bietet ihm Unterkunft. Später ist es eine eigene Hütte, die zu dessen Zuhause wird. Viele Jahre später, oft sitzt der nun alt gewordene Mann im Wirtshaus. Irgenwie gehört er inzwischen dazu, und doch wieder nicht. Sehr unterschiedlich ist das Empfinden der Menschen im Dorf. Von Fremdheit, Befremden, Interesse, leichter Annäherung bis hin zu einer Art Freundschaft, gar Verbundenheit, ist alles mit dabei. Gerade die junge Wirtstochter des Gasthofs hat da ein Gefühl von Nähe zu ihm entwickelt und das Kind lauscht fasziniert den Geschichten des Alten. Und auch drumherum wird dieser Roman getragen von Geschehnissen, Gedanken, Geschichten, die das Leben schreibt, ruhig, unaufgeregt, gottergeben von den Menschen dieser kleinen Gemeinschaft angenommen. Und trotzdem ist das Alles so intensiv und ausgestattet mit der gesamten Bandbreite an Gefühlen, dass es einen für die Zeit des Lesens sehr einbindet in diese Lebenswelt. Dies erfolgt, so echt, sicherlich auch durch den sehr eigenen Schreibstil, den die Autorin hier wählt. Und deren eigene Vita, die als Wirtstochter in den 1970er-Jahren beginnt, sie fließt in ergeblichem Maße ein in diesen Roman, die so viel über Geschichte erzählt, pur und fesselnd nah dran.
Ein sehr beeindruckendes Buch, mit auf relativ wenigen Seiten so viel Leben.