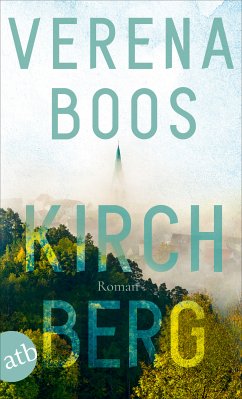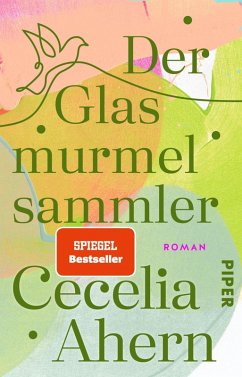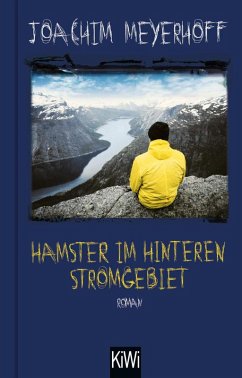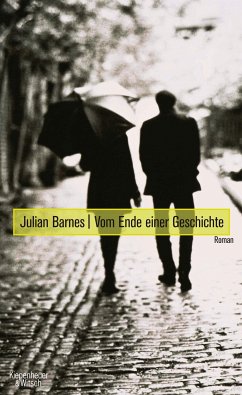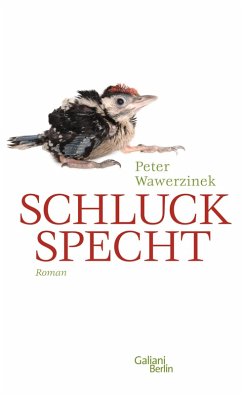Du stirbst nicht (eBook, ePUB)
Roman
Sofort per Download lieferbar
Statt: 19,95 €**
9,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Vom Hirnschlag erwacht - die atemberaubende Geschichte einer Heilung Helene Wesendahl weiß nicht, wie ihr geschieht: Sie findet sich im Krankenhaus wieder, ohne Kontrolle über ihren Körper, sprachlos, mit Erinnerungslücken. Ihr Weg zurück ins Leben konfrontiert sie mit einer fremden Frau, die doch einmal sie selbst war. Kathrin Schmidt packt ihre Leser diesmal durch die Beschränkung, und zwar im wörtlichen Sinne. Mit den Augen ihrer erwachenden Heldin blicken wir in ein Krankenzimmer, auf andere Patienten, das Pflegepersonal und den eigenen Körper, der plötzlich ein Eigenleben zu füh...
Vom Hirnschlag erwacht - die atemberaubende Geschichte einer Heilung Helene Wesendahl weiß nicht, wie ihr geschieht: Sie findet sich im Krankenhaus wieder, ohne Kontrolle über ihren Körper, sprachlos, mit Erinnerungslücken. Ihr Weg zurück ins Leben konfrontiert sie mit einer fremden Frau, die doch einmal sie selbst war. Kathrin Schmidt packt ihre Leser diesmal durch die Beschränkung, und zwar im wörtlichen Sinne. Mit den Augen ihrer erwachenden Heldin blicken wir in ein Krankenzimmer, auf andere Patienten, das Pflegepersonal und den eigenen Körper, der plötzlich ein Eigenleben zu führen scheint. Und wir erleben die mühsamen Reha-Maßnahmen mit, die Reaktionen der Familie, den aufopferungsvollen Einsatz ihres Mannes - und die bruchstückhafte Wiederkehr ihrer Erinnrung. Was da zutage tritt, konfrontiert Helene mit einem Leben, in dem sie sich kaum wiedererkennt, und das vieles in Frage stellt, was in der neuen Situation so selbstverständlich scheint. Sie entdeckt frühe Brüche in ihrer Biographie, verdrängte Leidenschaften und aus der Not geborene Verpflichtungen. Als ihr bewusst wird, dass ihr Herz sich bereits auf Abwege begeben hatte und sie den Mann, der sie jetzt so eifrig pflegt, eigentlich verlassen wollte, droht sie den Boden unter den Füßen zu verlieren. Kathrin Schmidt gelingt das Erstaunliche: Sie macht den Orientierungs- und Sprachverlust nach einer Hirnverletzung erfahrbar und zeigt einen Weg der Genesung, der in zwei Richtungen führt, zurück und nach vorn. Dabei entsteht ein Entwicklungsroman ganz eigener Art, der durch seine innere Dynamik fesselt und durch die Rückhaltlosigkeit, mit der seine Heldin sich mit ihrer Vergangenheit und Gegenwart konfrontiert, fasziniert. Er überzeugt vor allem durch die bewegende Schilderung eines sprachlichen Neubeginns.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.