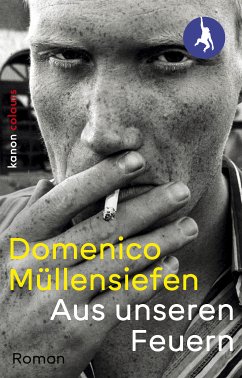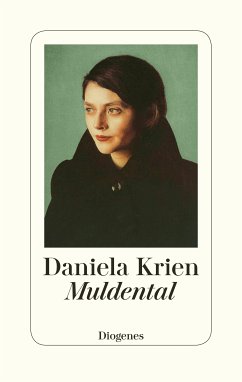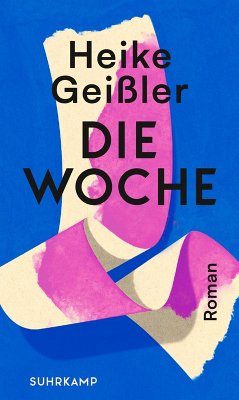E. oder Die Insel (eBook, ePUB)
Sofort per Download lieferbar
Statt: 24,00 €**
11,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
April 1945, auf einer Insel in der Mulde. In einem Gebüsch hält sich ein Mann versteckt. Seine Knie sind aufgeschlagen, seine Sachen nass, in der Ferne ist das Geräusch krachender Haubitzen zu hören. Er blickt auf das Pfarrhaus am Ufer, in dem er mit seiner Frau und den Kindern gelebt hat. Aber jetzt sind sie weg. Sie scheinen verschleppt worden zu sein, und er ist sich sicher, dass ihr Verschwinden etwas mit ihm zu tun hat. Er versucht sich zu erinnern. Ein Mann mit einem Klumpfuß kommt ihm in den Sinn. Und ein kleines Mädchen, von dem er nach und nach zu erzählen beginnt. Was er sieht...
April 1945, auf einer Insel in der Mulde. In einem Gebüsch hält sich ein Mann versteckt. Seine Knie sind aufgeschlagen, seine Sachen nass, in der Ferne ist das Geräusch krachender Haubitzen zu hören. Er blickt auf das Pfarrhaus am Ufer, in dem er mit seiner Frau und den Kindern gelebt hat. Aber jetzt sind sie weg. Sie scheinen verschleppt worden zu sein, und er ist sich sicher, dass ihr Verschwinden etwas mit ihm zu tun hat. Er versucht sich zu erinnern. Ein Mann mit einem Klumpfuß kommt ihm in den Sinn. Und ein kleines Mädchen, von dem er nach und nach zu erzählen beginnt. Was er sieht, hört und denkt, schreibt er auf. Ein Abschiedsbrief an seine Frau. Ein Bericht, mit dem er Zeugnis ablegt. Er notiert seine Worte auf der Rückseite von Akten. Sie liegen in dem Koffer, den er bei sich führt, zwischen Dosenfleisch, einer zersplitterten Uhr und einem langsam hart werdenden Laib Brot. Ein Roman, dessen Fassade langsam zerbricht und der die Abgründe unter der dünnen Firnis der Zivilisation sichtbar macht. "Ein dunkler Roman über einen Arzt, der gefangen ist auf der Insel seines Denkens. Ich kenne nichts Vergleichbares in der deutschen Gegenwartsliteratur." (Gunnar Cynybulk)
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.