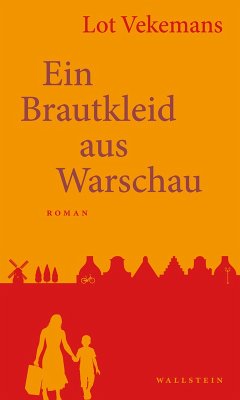Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Gleich drei Dramatiker gehen fremd und veröffentlichen ihre ersten Romane: Roland Schimmelpfennig, Nis-Momme Stockmann und Lot Vekemans. Alle drei sind mit diesen Romanen für literarische Auszeichnungen nominiert. Zu Recht?
IIst das was Ernstes? Folgenreicher Betrug? Oder nur ein kurzer Sprung zur Seite. Ins Nebenbecken. Zum Abkühlen, Untertauchen, Schwungholen. Lohnt überhaupt die quälende Frage nach dem Warum? Warum gerade jetzt, warum mit ihm, warum überhaupt? Oder wäre schweigendes Darüber-Hinwegsehen klüger? Erst einmal abwarten, wie lange das Abenteuer seinen Reiz behält.
Gleich drei Dramatiker gehen dem Theater in diesem Bücherfrühling mit dem Roman fremd. Drei Bühnenautoren wechseln die narrative Gangart, das darstellende Medium, tauschen Drama gegen Prosa ein. Und werden dafür auch gleich ausgezeichnet. Zwei von ihnen, Roland Schimmelpfennig und Nis-Momme Stockmann, sind mit ihren Debütromanen auf der Shortlist des Preises der Leipziger Buchmesse. Die dritte Seitenspringerin, die niederländische Dramatikerin Lot Vekemans, wurde in ihrer Heimat schon preisgekrönt. Aber - jenseits aller öffentlichen Anerkennung - lohnt sich der Dramatiker-Schritt vom Wege auch für die Leser?
Ja, allein schon wegen des Titels, ist man versucht mit Blick auf Roland Schimmelpfennig zu sagen: "An einem klaren, eiskalten Januarmorgen zu Beginn des 21. Jahrhunderts". Das klingt so schön fundamental, dass allerdings von dem, was danach kommt, nicht mehr viel bleibt. Der Inhalt fällt hier hinter den Titel zurück. Denn auch wenn Schimmelpfennig bestechend nüchtern vom Schicksal und seinen diversen Tiefschlägen erzählt, mit unaufdringlicher Geste beschreibt. wie ein junges Liebespaar aus dem Berliner Umland vor verwahrlosten Familienzusammenhängen flüchtet und sich zu Fuß in die Großstadt aufmacht, wie ein stummer polnischer Bauarbeiter von seiner Freundin betrogen wird und ein Späti-Betreiber den Verstand verliert, obwohl er bei alldem die Traurigkeit der Abgehängten und Verlorengegangenen immer wieder andeutet - bleibt es am Ende doch bei unverbundenen Episoden, fehlt der Mut zum erzählerisch verdichtenden Ausfallschritt.
Da hilft auch ein einsamer Wolf nicht, der als heimlicher Spielleiter die Szenen miteinander verbinden soll. Zu viele Nebendarsteller treten auf, zu wenig existentielle Rahmenhandlung findet statt. Als würde der Dramatiker seiner Erzählung die Lebensenergie mit Absicht entziehen, als ob er schon vom Tempo her mit aller Kraft unterbieten wolle, was er in seinen Theaterstücken gewöhnlich auf den Weg bringt: hin und her schnellende Dialoge, überraschende Wendungen, scharfgestellte Ironie.
Die kurze, lakonische Form der Beschreibung führt in Schimmelpfennigs Prosa manchmal geradewegs zur Unterkühlung. Die Figuren bleiben oft statisch, bilden nur den Hintergrund für Bilder, die symbolisch überladen werden: ein toter Jäger im Schnee, ein Feuer in der Winternacht, ein Wolf vor den Toren der Stadt und ein Trinker, der in sich zusammensackt, während "ein paar Meter entfernt jemand Bratwürste verkauft". Schimmelpfennig gibt sich immer wieder mit der Erzeugung von Stimmungen zufrieden und macht gar nicht erst den Versuch, daraus eine Handlung, ein Geschehen zu entwickeln.
Und doch gelingen ihm berührende Momentaufnahmen, wie die vom greisen Paar im Erdgeschoss eines völlig entkernten Berliner Mietshauses: Ein halbnackter Greis schneidet bei Kerzenschein eine Fleischwurst in Stücke und schleudert sie auf den Fußboden, von dem sie seine alte, zahnlose Frau tief gebeugt zusammensammelt. Hier reicht das eine Bild, um alles zu erzählen: die Grausamkeit des gemeinsamen Alterns, die Schmach, die es bedeutet, aufeinander angewiesen zu sein.
Schimmelpfennigs Roman ist da am stärksten, wo er szenisch, nicht wo er narrativ schreibt: Eine Vernissage hinter der Fensterscheibe, eine Frau mit roten Schuhen und ein Mann mit grauen Haaren, lachend erst, dann, plötzlich, schlägt sie ihm ins Gesicht. Ein Ausbruchsversuch aus dem gewöhnlichen Smalltalk. Emblem für den Irrsinn des Kulturbetriebs. Und eine waschechte Theaterszene. Die man gern möglichst bald auf der Bühne sehen würde. Der Gattungswechsel hat bei Schimmelpfennig nicht zum großen Gegenentwurf geführt. Sein Roman bleibt ein ungeschriebenes Theaterstück. Er wirft zu wenig Prosa-Fleisch auf die Waage, die zersplitterten Short Cuts fügen sich nur zu einem mageren Ganzen zusammen.
Das Gegenteil kann man von Nis-Mommse Stockmanns Debütroman "Der Fuchs" behaupten. Hier hat die Wucht, mit der das Erzählfleisch geworfen wurde, die Waagschale geradewegs in den Bewertungsboden gerammt. Was auch immer nur von Ferne an Theaterszenen erinnern könnte, ist vollkommen überschüttet worden mit ausufernder, elliptischer Prosa. 715 Seiten lang ist der Roman des 1981 geborenen Dramatikers, dessen Stücke seit 2009 meist auf den kleinen Bühnen der großen Häuser gespielt werden. Denen oft vorgehalten wurde, in ihrer Themenwahl allzu autobiographisch zu sein: das schwierige Vater-Sohn-Verhältnis, die Asozialität der Vorortsiedlung, die theoriegesättigten Uni-Seminare. Damit hält der Prosaautor Stockmann sich nicht lange auf. Sein erstes Buch feiert die Apokalypse. Und stellt damit selbst alles in den Schatten, was er bisher fürs Theater geschrieben hat.
Eine enorme Flutwelle hat die norddeutsche Kleinstadt Thule heimgesucht und ein Inferno biblischen Ausmaßes angerichtet: Aufgedunsene Seniorenleiber hängen in den Baumkronen, Tiere mit heraushängenden Eingeweiden kämpfen um ihr Leben, Babys brüllen, Hubschrauberwracks knallen gegen Hauswände, ein stinkender flüssiger Müllteppich fließt zäh ins Nirgendwo. Götterdämmerung im Juli 2012 - "der Kosmos kotzt". Ein paar Überlebende haben sich aufs Dach gerettet. Unter ihnen ist Finn Schliemann. Auf den immer schon alles eingestürzt ist, der sich sein Gehirn stets von anderen hat "besticken lassen" und dabei nichts als einen seltsam metallischen Geschmack im Rachen hatte. Von der Katastrophe erschöpft, hockt er jetzt mit "verkrampften Augenlidern" in der Gluthitze und fällt immer wieder ins Delirium.
Erinnerung und Phantasma verschwimmen, bald schieben sich wahnsinnige Bilder wild übereinander: abgerissene Traumfetzen, Mythenvisionen, Kindheitsrückblenden. Hin und wieder bildet sich ein erzählerischer Strang heraus, springt die Handlung in die frühen 1990er Jahre, als der zehnjährige Finn - dessen Bruder schwerbehindert, dessen Vater von eigener Hand (durch Abtrennung derselben!) gestorben und dessen Freundeskreis auf ein paar traurige Außenseiter beschränkt ist - Katja kennenlernt. Sie ist keine von diesen "inzestuösen Schmalzfressen, keine Allerweltsbratze", wie sie sonst in der Stadt rumhängen. Gemeinsam machen sich die beiden auf die Suche nach einem unsichtbaren Imperium, recherchieren, imaginieren, finden in der Fiktion den Ausweg aus der Hölle der Provinz. Als eines Tages ein blutender Menschenarm in der Hecke hängt, wird es ernst: "Klingenmänner" mit roten Augen und vernarbter Haut treten auf, eisiger Wind weht aus schwarzen Löchern, Käferschwärme verdunkeln das Sonnenlicht. "Du musst immer so leben, dass du im Falle einer Apokalypse gut dastehst", rät Katja und gibt Finn den Decknamen "Fuchs". Längst kann der da schon Fiktion und Realität nicht mehr voneinander trennen. Aber wozu auch, denn: Verstehen bedeutet immer Vorstellen, "Erinnern immer Erfinden".
Das ist gewissermaßen die erkenntnistheoretische Zwischenbilanz, die Stockmann (mit Verweis auf David Hume) zieht. Aber dafür hätten es vielleicht auch weniger Seiten getan. Was wirklich interessant ist an diesem Roman, was einen mitreißt und anfixt, ist seine halsbrecherische Überladung mit Narrativen. Was zunächst wie eine Mischung aus Splatter-Romantik, barockem Allegorien-Schwulst und klassischem Abenteuerroman daherkommt, verwandelt sich im nächsten Moment in eine tragische Coming-of-Age-Story, wird bald darauf zur Edgar-Allen-Poe-haften Gruselgeschichte, springt wild hin und her zwischen babylonischem Götterkampf und trister SPD-Kommunalpolitik und endet schließlich irgendwo im Chaos der Zeitenwende. Ab der Hälfte des Buches sind die einzelnen Textpassagen versetzt gedruckt, damit der Leser eine bessere Übersicht behält. Tut er aber nicht. Im Gegenteil, alles verschwimmt, wird zum aussichtslosen Puzzlespiel, kein Teil passt zum anderen, ein wildwucherndes Wurzelgeflecht aus furioser Phantasmagorie.
Bald achtet man nur noch auf den geradezu artistischen Tonlagenwechsel: Mal umgangssprachlich rauh, mal lyrisch-melodisch klingt Stockmanns Prosa-Stimme, sie kann verraucht erzählen wie ein Lagerfeueropa und stylisch in "Matrix"-Manier schocken. Hinter all dieser, manchmal auch nervtötenden poetologischen Registerzieherei taucht an verschiedenen Stellen der sehnsuchtsvolle Gedanke auf, dass diese - unsere - graue Zeit bald von einer ungeheuren Veränderung erschüttert werde. Dass das leblose Netzwerk, in dem "alles miteinander verbunden ist, aber sich nichts mehr berührt", zusammenbreche und unsere "emotional begradigte Welt" mit einem lauten Knall untergehe.
Der Wunsch nach Neustart, nach einem Leben jenseits vom Zynismus des "Wohlstandsprojekts" steckt Stockmanns "Fuchs" tief in den Knochen. Aus ihm heraus entwickelt er eine überdrehte Erzähl-Collage, die mit ihrer spezifischen Form der poppigen Archaik den Anschluss an die postmoderne Tradition der Apokalypsen-Sehnsucht sucht. "Irgendwo muss doch das stattfinden, was die Menschen ,Geschichte' nennen", flüstert Stockmann dem Leser einmal zu, "was das heißen kann: Am Leben sein." Da hält er für einen Moment inne, ist kurz stiller Träumer. Aber häufig passiert das nicht. Die meiste Zeit schmeißt er sich fast manisch in immer neue Strukturwellen hinein. Während Schimmelpfennigs "Wolfs"-Roman das Theater unter Wert betrügt, schläft sich Stockmann mit seinem "Fuchs"-Prosawerk ganz nach oben.
Man ringt mit diesem Buch, zweifelt, versucht die Gegenwehr und muss sich am Ende doch seiner fundamentalen Erzählkraft, seinem unerschöpflichen Assoziationsreservoir ergeben. Das ist ein echter Wurf. Ein Schleuderwurf.
Zuletzt noch Vekemans. Die Dramatikerin aus Holland, deren erfolgreichstes Theaterstück "Gift" von der Wiederbegegnung eines geschiedenen Elternpaares am Grab des verunglückten Sohnes handelt. Angeblich soll es umgebettet werden, weil Gift auf dem Friedhof gefunden wurde, in Wahrheit ist das nur eine Erfindung der Frau, die ihren Mann wiedersehen will, das einsame Leiden, das Verlassen-Sein nicht mehr aushält. Unvergesslich, wie Dagmar Manzel in der aktuellen Inszenierung von "Gift" am Deutschen Theater in Berlin den Blick flehentlich auf Ulrich Matthes richtet und der, alle aufkommende Trauer unterdrückend, allen verzweifelten Wahnsinn seiner Exfrau abwehrend, die Flucht ins Ironische versucht. In "Gift" bleibt die Frau zurück, während der Mann zu seiner neuen Familie heimkehrt.
In Vekemans erstem Roman, "Ein Brautkleid aus Warschau", sind es jetzt die Männer, die zurückbleiben. Es ist die Geschichte von Marlena, einer jungen Polin vom Dorf, die nicht an die Treue ihres verzweifelten Geliebten glaubt, aber schwanger ist und sich von einer Heiratsagentur nach Holland zu einem verwitweten Bauern vermitteln lässt. Dort dann lebt, ihren Sohn aufzieht, den neuen Ehemann zum Vater macht, nur um ihn eines Tages kaltblütig zu verlassen und heimzukehren nach Polen, ohne Mitleid für den Schmerz des schweigsamen Landwirts, der seinen falschen Sohn liebt wie nichts auf der Welt. Marlena flieht zu einem, der sie immer schon wollte, einem reichen Hotelier mit Geld und einem Geheimnis, das der vor Kummer verstockte Sohn zufällig lüftet. Und wieder bricht Marlena auf, reißt ihren kleinen Jungen mit sich fort. Immer gehen, nie bleiben.
Lot Vekemans skizziert mit wenigen Strichen das Porträt einer Frau, die jedes Vertrauen aufs Gefühl verloren hat. Deren Leben Flucht ist vor allem, was Liebe war und sein könnte. Aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt sie das Geschehen, auch aus der der Männer. Aber Gerechtigkeit erfährt hier trotzdem niemand. Und so bleibt jeder ihrer Figuren am Ende nur der schwermütige Gedanke an "ein Leben, das man nicht gehabt hat". Vekemans schreibt in einem altmodischen Sinne empfindsam, berührt durch die ruhige Art ihrer Seelenschau, ihres einfühlsamen psychologischen Realismus. Man stört sich nicht an ihrem klassizistischen Motiv-Repertoire, daran, dass hier Küsse unter Linden ausgetauscht werden und Geheimnisse in Briefen versteckt sind. Wenn die Konvention so herzklopfend daherkommt, nimmt man sie gerne in Kauf. Vekemans erster Roman ist eine formvollendete Fortsetzung des Dramas mit anderen Mitteln. Sie malt, so könnte man sagen, feinfühlig aus, was für die Bühne geschrieben, in gesprochener Rede immer Schema bleibt: das Innenleben der Menschen, die da oben ostentativ handeln, fehlen und leiden müssen.
Und das darf am Ende doch als der größte Triumph der Prosa gelten, wenn es ihr gelingt, das auszufüllen, was das Drama an heimlichen Leerstellen offenlässt. Dann lohnt sich der Betrug auch für das betrogene Theater.
SIMON STRAUSS
Roland Schimmelpfennig: "An einem klaren, eiskalten Januarmorgen zu Beginn des 21. Jahrhunderts". Roman. S. Fischer, 256 Seiten, 19,99 Euro
Nis-Momme Stockmann: "Der Fuchs". Roman. Rowohlt, 720 Seiten, 24,95 Euro
Lot Vekemans: "Ein Brautkleid aus Warschau". Roman. Wallstein, 253 Seiten, 19,90 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH