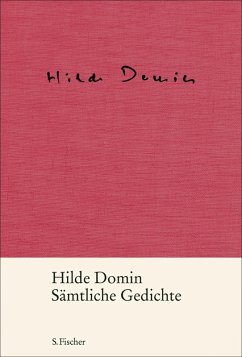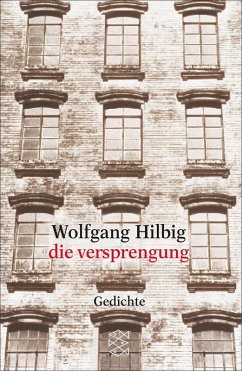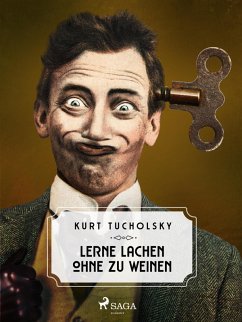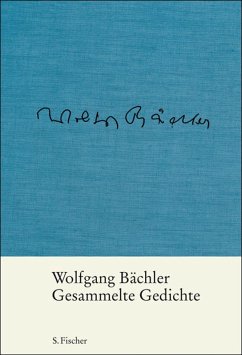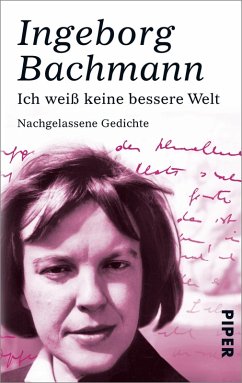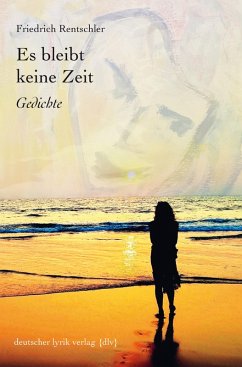Ein Jahr hat keine Zeit (eBook, ePUB)
Gedichte
Redaktion: Böll, René; Ewenz, Gabriele; Schubert, Jochen
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
Statt: 20,00 €**
16,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
»Herr Hauptmann, ach, o halten Sie doch jetzt die Fresse, in diesem Augenblick ertrag' ich Unsinn nicht!« - Heinrich Bölls lyrisches Werk. Wenn man an Heinrich Böll denkt, denkt man an Prosa. Und doch hat er zeitlebens auch Lyrik geschrieben, von den jungen Jahren an bis ins hohe Alter. Die Gedichte sind kein Nebenprodukt seines Schreibens, sondern wichtiger Werkbestandteil. Diese bibliophile Ausgabe macht sie zum ersten Mal sorgsam ediert verfügbar. Böll als Lyriker entdecken, heißt, einen Autor in seiner Stimmfindung erleben. Angefangen bei den ersten lyrischen Gehversuchen, in denen ...
»Herr Hauptmann, ach, o halten Sie doch jetzt die Fresse, in diesem Augenblick ertrag' ich Unsinn nicht!« - Heinrich Bölls lyrisches Werk. Wenn man an Heinrich Böll denkt, denkt man an Prosa. Und doch hat er zeitlebens auch Lyrik geschrieben, von den jungen Jahren an bis ins hohe Alter. Die Gedichte sind kein Nebenprodukt seines Schreibens, sondern wichtiger Werkbestandteil. Diese bibliophile Ausgabe macht sie zum ersten Mal sorgsam ediert verfügbar. Böll als Lyriker entdecken, heißt, einen Autor in seiner Stimmfindung erleben. Angefangen bei den ersten lyrischen Gehversuchen, in denen deutlich sein früher Lektürekanon mitschwingt (und sich alles ordentlich reimt!), über freie Klangexperimente wie dem Gedicht »Preußentum« (1938), das seinen Gegenstand in eine absurd-militaristische Lautfolge zerlegt - »Ra Ta, / Tra Ra / Ra Ta Ta! [...] Romm, Bomm, Bomm ...« - bis zu den späteren Texten, aus denen ein Böll spricht, den man im Ohr zu haben meint: mit all seinem warmen und doch immer scharfzüngigen Humor, seiner gelassenen Menschenfreundlichkeit, seiner politischen Wachsamkeit. Die Veröffentlichung einer so umfassenden Auswahl mit teils unveröffentlichtem Material ist eine Premiere. Und ein Geschenk für alle, die Böll bereits gut kennen oder auch über die kurze Form neu kennenlernen möchten.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.