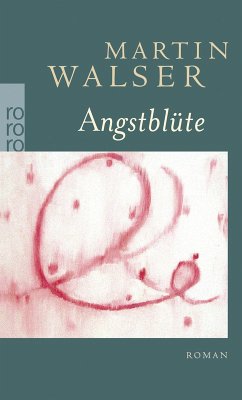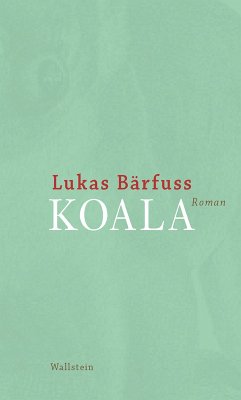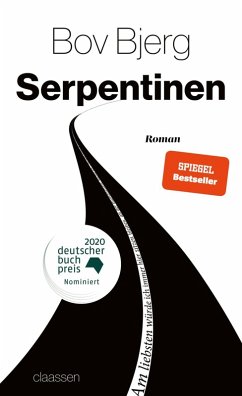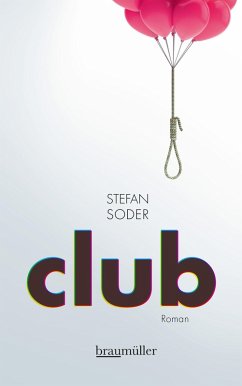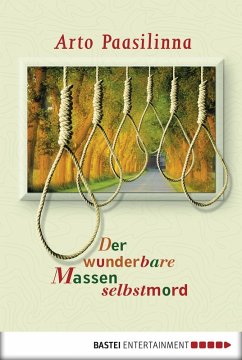Martin Walser
eBook, ePUB
Ein sterbender Mann (eBook, ePUB)
Sofort per Download lieferbar
Statt: 19,95 €**
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!






Theo Schadt, 72, Firmenchef und auch als «Nebenherschreiber» erfolgreich, wird verraten. Verraten ausgerechnet von dem Menschen, der ihn nie hätte verraten dürfen: Carlos Kroll, seinem engsten und einzigen Freund seit 19 Jahren, einem Dichter. Beruflich ruiniert, sitzt Theo Schadt jetzt an der Kasse des Tangoladens seiner Ehefrau in der Schellingstraße in München. Und weil er glaubt, er könne nicht mehr leben, wenn das, was ihm passiert ist, menschenmöglich ist, hat er sich in einem Online-Suizid-Forum angemeldet. Da schreibt man hin, was einem geschehen ist, und kriegt von Menschen An...
Theo Schadt, 72, Firmenchef und auch als «Nebenherschreiber» erfolgreich, wird verraten. Verraten ausgerechnet von dem Menschen, der ihn nie hätte verraten dürfen: Carlos Kroll, seinem engsten und einzigen Freund seit 19 Jahren, einem Dichter. Beruflich ruiniert, sitzt Theo Schadt jetzt an der Kasse des Tangoladens seiner Ehefrau in der Schellingstraße in München. Und weil er glaubt, er könne nicht mehr leben, wenn das, was ihm passiert ist, menschenmöglich ist, hat er sich in einem Online-Suizid-Forum angemeldet. Da schreibt man hin, was einem geschehen ist, und kriegt von Menschen Antwort, die Ähnliches erfahren haben. Das gemeinsame Thema: der Freitod. Eines Tages, er wieder an der Kasse, löst eine Kundin bei ihm eine Lichtexplosion aus. Seine Ehefrau glaubt, es sei ein Schlaganfall, aber es waren die Augen dieser Kundin, ihr Blick. Sobald er seine Augen schließt, starrt er in eine Lichtflut, darin sie. Ihre Adresse ist in der Kartei, also schreibt er ihr - jede E-Mail der Hauch einer Weiterlebensillusion. Und nach achtunddreißig Ehejahren zieht er zu Hause aus. Sitte, Anstand, Moral, das gilt ihm nun nichts mehr. Doch dann muss er erfahren, dass sie mit dem, der ihn verraten hat, in einer offenen Beziehung lebt. Ist sein Leben «eine verlorene, nicht zu gewinnende Partie»? Martin Walsers neuer Roman über das Altsein, die Liebe und den Verrat ist beeindruckend gegenwärtig, funkelnd von sprachlicher Schönheit und überwältigend durch seine beispiellose emotionale Kraft.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
- Geräte: eReader
- ohne Kopierschutz
- eBook Hilfe
- Größe: 2.11MB
- FamilySharing(5)
- Text-to-Speech
- Entspricht WCAG Level AA Standards
- Entspricht WCAG 2.1 Standards
- Alle Inhalte über Screenreader oder taktile Geräte zugänglich
- Alle Texte können hinsichtlich Größe, Schriftart und Farbe angepasst werden
- ARIA-Rollen für verbesserte strukturelle Navigation
- Hoher Kontrast zwischen Text und Hintergrund (min. 4.5 =>1)
- Text und Medien in logischer Lesereihenfolge angeordnet
- Keine Einschränkung der Vorlesefunktionen, außer bei spezifischen Ausnahmen
- Entspricht EPUB Accessibility Specification 1.1
Martin Walser, 1927 in Wasserburg am Bodensee geboren, war einer der bedeutendsten Schriftsteller der deutschen Nachkriegsliteratur. Für sein literarisches Werk erhielt er zahlreiche Preise, darunter 1981 den Georg-Büchner-Preis, 1998 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und 2015 den Internationalen Friedrich-Nietzsche-Preis. Außerdem wurde er mit dem Orden «Pour le Mérite» ausgezeichnet und zum «Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres» ernannt. Martin Walser starb am 26. Juli 2023 in Überlingen.

© Philippe Matsas/Opale
Produktdetails
- Verlag: Rowohlt Verlag GmbH
- Seitenzahl: 288
- Erscheinungstermin: 8. Januar 2016
- Deutsch
- ISBN-13: 9783644054011
- Artikelnr.: 44399339
Der letzte Tango in München
Martin Walsers Roman "Ein sterbender Mann" ist eine absichtsvoll vertrackte Parodie über die Sprache der Liebe im Alter - und manche Kulturmenschen könnten sich darin wiedererkennen.
Mehr als schön ist nichts." Diesen Satz hat Martin Walser gleichsam als Köder für seinen neuen Roman ausgelegt. Der beginnt nämlich mit einem Brief an einen Schriftsteller, in dem sich der zweiundsiebzigjährige Theo Schadt über dessen Ausspruch beschwert. Er selbst sei nicht schön, deshalb müsse er sich gegen den Satz und seinen Autor zur Wehr setzen. Was er weiterhin über sich mitteilt, klingt allerdings verdächtig nach Martin Walsers Verhältnis zur medialen Öffentlichkeit: "Ich reagiere lieber, als dass ich
Martin Walsers Roman "Ein sterbender Mann" ist eine absichtsvoll vertrackte Parodie über die Sprache der Liebe im Alter - und manche Kulturmenschen könnten sich darin wiedererkennen.
Mehr als schön ist nichts." Diesen Satz hat Martin Walser gleichsam als Köder für seinen neuen Roman ausgelegt. Der beginnt nämlich mit einem Brief an einen Schriftsteller, in dem sich der zweiundsiebzigjährige Theo Schadt über dessen Ausspruch beschwert. Er selbst sei nicht schön, deshalb müsse er sich gegen den Satz und seinen Autor zur Wehr setzen. Was er weiterhin über sich mitteilt, klingt allerdings verdächtig nach Martin Walsers Verhältnis zur medialen Öffentlichkeit: "Ich reagiere lieber, als dass ich
Mehr anzeigen
nachdenke. Ich bin in meinen Reaktionen mehr enthalten als in meinen Nachdenklichkeiten. Dass mir das von den Verwaltern der Klugheit vorgeworfen werden kann, ist mir klar." Entsprechend erscheint Theo Schadt als Autor von "Ein sterbender Mann", der Roman besteht aus seinen Mitteilungen an den Schriftsteller, erst in der Ich-, später in der Er-Form. So betreibt Walser von vornherein ein Verwirrspiel mit der Autorschaft wie mit dem Begriff der Schönheit.
"Zu mir kommen die, die wie ich sind, die Verkrampften", schrieb Walser einmal in sein Tagebuch. Theo Schadt ist aber nicht nur wegen seines sprechenden Namens kein realistischer Briefschreiber, er ist eine Spielart des unzuverlässigen Erzählers. Was er zu berichten hat, erscheint als satirisch überzeichnete Folge einer verkrampften Wahrnehmung. Er besaß angeblich ein florierendes Unternehmen für Patentverwertungen nebst einer auf Naturprodukte spezialisierten Tochterfirma namens "Der Verschönerer". Außerdem sei er ein erfolgreicher Autor von Ratgeberliteratur gewesen, darunter einer "Anleitung zur Selbstbefriedigung". 98 Millionen Dollar habe er in die Produktion eines aus Schlangengift zu gewinnenden Mittels gegen Herzinfarkt investiert, dann jedoch sei er verraten worden und habe die Firma an seinen Hauptkonkurrenten verloren.
Der Verrat, über den der Leser nichts Genaues erfährt, scheint Schadts ausuferndes Mitteilungsbedürfnis zu bewirken, obendrein sorgt eine Krebsdiagnose für Torschlusspanik der Kommunikation und des Verhaltens. So beteiligt er sich an einem Suizidforum im Netz und trägt seine Geschichte in einer Talkshow vor. Er teilt eine Serie von Grandiositätsträumen sowie Aphorismen zum Alter mit und schreibt Eingaben an die Regierung der Art, sie möge "eine Propaganda gegen das Lesen in öffentlichen Verkehrsbetrieben" veranlassen, auf dass die Leute "einander wahrnehmen, erleben". Schließlich entdeckt Herr Schadt, das darf bei Walser nicht fehlen, in quasi mystischer Plötzlichkeit noch einmal die Liebe.
Der Verräter soll sein früherer, von ihm bewunderter Freund und Teilhaber Carlos Kroll sein, ein hochnäsiger Dichter, die Karikatur eines hermetischen Lyrikers, der behauptet, "seine Gedichte seien Sprachereignisse, die in dieser Zeit, in der das Mittelmaß triumphiere, gar nicht erkannt werden könnten". In der Konzeption der Figur hat Walser mit offensichtlichem Schalk alle bürgerlichen Ressentiments gegen die moderne Lyrik versammelt. Warum Herr Schadt jemanden bewundert hat, dessen Gedichtbände "Lichtdicht, Leichtlos, Lufthaft, Kettenscheu" oder auch "SeinsRiss" betitelt sind, ist einem der Lyrik geneigten Leser freilich schwer begreiflich. Carlos Kroll schwebt angeblich "ein Lyrik-Imperium à la Stefan George" vor, aber "keine elitäre Kunstkirche, sondern eine radikale Banalisierung". Dem werden die angeführten Beispiele allerdings gerecht: "Mit brennenden Füßen auf Eisschollen stehen, / vom Achtstundentag verschont, sich / preisgegeben, das Leben fürchtend / und den Tod, befreundet mit Frisuren." Das ist ganz lustig, wenn es sich nicht beim letzten Wort um einen Druckfehler handelt. Carlos versteht sich im Übrigen auch auf Kurzsätze à la Walser: "Man gleicht sich nicht."
Die Handlung des Romans spielt im Milieu des Münchner Bildungsbürgertums, das bekanntlich mehr als andernorts zur alternativen Freizeitgestaltung von Yoga bis zum Tangotanzen neigt, aber auch zum Mäzenatentum. Ein geeigneter Ort, die Kunst wie sich selbst zu feiern, ist das von Ursula Haeusgen gestiftete Lyrik Kabinett. Das ist angesichts des vielbeklagten Bedeutungsverlusts der Lyrik eine verdienstvolle Institution, gleichwohl ist es nicht schwer, sich über die weihevolle Stimmung bei den Lesungen ein wenig lustig zu machen. Herr Schadt kann dem auch nicht widerstehen, tut aber ganz naiv.
Bei der Preisverleihung an Carlos Kroll stürzt zunächst der betagte Vorsitzende des "Vereins für Gute Dichtung" auf das Podium. Die Laudatio hält dann, "graues Haargefluder um den Kopf, das nie eine Frisur erlebt hatte", ein Literaturprofessor der Münchner Universität. Der weiß zwar offenbar nicht, wann Georges Gedichtband "Das Jahr der Seele" erschienen ist, führt aber aus, dass Carlos Kroll "andauernd seine eigene Existenz in Sprachgesten erlebe, die immer das Ganze, das große Ganze, fassen und ausdrücken wollen". Die Parodie des Jargons der Eigentlichkeit ist ein bisschen billig und kommt auch sechzig Jahre zu spät, aber da außer auf George auch auf Enzensberger und Celan verwiesen wird, ahnt der Leser ein wenig Walsersche Hinterhältigkeit. Der Dichter dankt jedenfalls trocken dafür, dass er "bis zur Verständlichkeit heruntergeredet" worden ist.
Beim anschließenden Diner erklingen dann noch ein paar salbungsvolle Worte, ehe Herrenwitze der schlechteren Art erzählt werden, bei denen sich nicht unerwartet der Literaturprofessor besonders hervortut. Eine Figur aber, der Konsul Danielus, wird von der grobschlächtigen Satire verschont. Der spricht mit Wilhelm Grimm von der "Beweglichkeit der Sprache", in der "doch alle nur mitgeführte Figuren" seien. So könnten die Menschen einander nicht für das Gesagte verantwortlich machen, es habe aber, 1849 in der Paulskirche zu Frankfurt, einen Ort gegeben, an dem "phrasenfrei gesprochen werden konnte".
Das kann man von dem Suizidforum, an dem sich Herr Schadt unter dem Namen Franz von M. - nämlich "Moor" nach Schillers "Kanaille" - beteiligt, eher nicht sagen. Er verliebt sich zunächst in den Begriff "irreversibel", mit dem eine unter "Aster" firmierende Teilnehmerin ihren Entschluss zur Selbsttötung bezeichnet, und dann in die Person, die er sich vorstellt, teilt ihr aber zugleich mit, dass er kein "brauchbarer Mann" mehr ist.
Im Laden für Tangobedarf, den seine Frau Iris betreibt, an der Kasse sitzend, blickt er derweil plötzlich in dunkle Augen "aus einem blendenden Lichtgewoge". Die Augen gehören zu Sina Baldauf, für die Tangotanzen eine "Parallelwelt" darstellt. Mit ihr beginnt er einen ausufernden Briefwechsel, ihr will er nun "andauernd etwas Schönes sagen". Da wird dann Herr Schadt höchstselbst zum Lyriker: "Welt reimt sich auf Sinn, / wie sich Blüte auf Liebe reimt. / Ich fühle, dass in mir / immer etwas keimt." Damit nicht genug der Wesensveränderung, wegen dieser sprichwörtlichen Liebe auf den ersten Blick verlässt er das "schutzreiche Haus" seiner getreuen Ehefrau, der "göttlichen Iris".
Der Briefwechsel mit Sina Baldauf wie der mit "Aster" belegt Niklas Luhmanns Diktum, dass Liebe nicht in erster Linie ein Gefühl ist, sondern ein symbolisch generalisierendes Kommunikationsmedium. Unentwegt schreiben sie sich Schönes, bis sie glauben, dass sie etwas füreinander sind oder gar ohneeinander nicht sein können. Doch dann stellt sich alles, selbst die Eifersucht auf Sinas Tangoerlebnisse, als doppeltes Missverständnis heraus. Da eifert Herr Schadt dem alten Goethe nach und schreibt auch eine "Elegie". Und wie Goethes letzte Liebe zu Ulrike von Levetzow könnte Sina sagen: "Eine Liebschaft war es nicht." Herrn Schadts Version der Entsagung besteht aber darin, dass er nun keinerlei Wirklichkeit mehr dulden will. "Ich bilde mir ein, was ist." Das ist deutscher Idealismus, der die Liebe als schöpferische Kraft feierte, die Erfüllung aber vor allem in schönen Briefen fand. Nicht zufällig gibt es bei der Preisverleihung im Lyrik Kabinett eine Gedenkminute für Karoline von Günderode, die sich am Rheinufer erdolchte, als sie ihre Liebe verraten fand. Auch in "Ein sterbender Mann" sind entsprechend Todesfälle zu beklagen, Herr Schadt aber bleibt am Leben.
Dem Schriftsteller teilt er mit, dass sein Satz "Mehr als schön ist nichts" verbessert werden muss wegen einer, die eben mehr als schön war. "Sie war alles." Das ist aber auch übertrieben. Daher meldet sich zum Schluss der nunmehr "so genannte Schriftsteller" nur noch mit ein paar apart formulierten Binsenweisheiten über das Vergehen der Zeit zu Wort.
In dem Faksimile eines handschriftlichen Briefes an die, "die damit zu tun haben", hat Martin Walser angeregt, den Roman als "Selbstportrait" und als Geschichte von einem zu lesen, der dem Tod nahe ist und dann feststellt, dass es schöner wäre, zu leben. Das ist aber nur eine weitere Finte in Walsers Spiel mit der Autorschaft. Wer eine ironisch-sentimentale Geschichte über die "Niederlage des Alters" erwartet, das Komische wie das Elegische der späten Liebestorheit, wird enttäuscht sein.
Denn "Ein sterbender Mann" ist ein trickreiches Kunststück, in dem Walser mit der Sprache absichtsvoll auch die überladene Konstruktion des Romans scheitern lässt. Der erfahrene Romancier demonstriert, dass er eine Welt aufbauen und wieder zusammenbrechen lassen kann. Das erregt die Bewunderung des Lesers, erreicht aber durch ein Übermaß an bis ins Alberne getriebener Parodie, die an Liebesverrat grenzt, nicht sein Herz.
FRIEDMAR APEL
Martin Walser: "Ein
sterbender Mann". Roman.
Rowohlt Verlag, Reinbek 2016. 288 S., geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Zu mir kommen die, die wie ich sind, die Verkrampften", schrieb Walser einmal in sein Tagebuch. Theo Schadt ist aber nicht nur wegen seines sprechenden Namens kein realistischer Briefschreiber, er ist eine Spielart des unzuverlässigen Erzählers. Was er zu berichten hat, erscheint als satirisch überzeichnete Folge einer verkrampften Wahrnehmung. Er besaß angeblich ein florierendes Unternehmen für Patentverwertungen nebst einer auf Naturprodukte spezialisierten Tochterfirma namens "Der Verschönerer". Außerdem sei er ein erfolgreicher Autor von Ratgeberliteratur gewesen, darunter einer "Anleitung zur Selbstbefriedigung". 98 Millionen Dollar habe er in die Produktion eines aus Schlangengift zu gewinnenden Mittels gegen Herzinfarkt investiert, dann jedoch sei er verraten worden und habe die Firma an seinen Hauptkonkurrenten verloren.
Der Verrat, über den der Leser nichts Genaues erfährt, scheint Schadts ausuferndes Mitteilungsbedürfnis zu bewirken, obendrein sorgt eine Krebsdiagnose für Torschlusspanik der Kommunikation und des Verhaltens. So beteiligt er sich an einem Suizidforum im Netz und trägt seine Geschichte in einer Talkshow vor. Er teilt eine Serie von Grandiositätsträumen sowie Aphorismen zum Alter mit und schreibt Eingaben an die Regierung der Art, sie möge "eine Propaganda gegen das Lesen in öffentlichen Verkehrsbetrieben" veranlassen, auf dass die Leute "einander wahrnehmen, erleben". Schließlich entdeckt Herr Schadt, das darf bei Walser nicht fehlen, in quasi mystischer Plötzlichkeit noch einmal die Liebe.
Der Verräter soll sein früherer, von ihm bewunderter Freund und Teilhaber Carlos Kroll sein, ein hochnäsiger Dichter, die Karikatur eines hermetischen Lyrikers, der behauptet, "seine Gedichte seien Sprachereignisse, die in dieser Zeit, in der das Mittelmaß triumphiere, gar nicht erkannt werden könnten". In der Konzeption der Figur hat Walser mit offensichtlichem Schalk alle bürgerlichen Ressentiments gegen die moderne Lyrik versammelt. Warum Herr Schadt jemanden bewundert hat, dessen Gedichtbände "Lichtdicht, Leichtlos, Lufthaft, Kettenscheu" oder auch "SeinsRiss" betitelt sind, ist einem der Lyrik geneigten Leser freilich schwer begreiflich. Carlos Kroll schwebt angeblich "ein Lyrik-Imperium à la Stefan George" vor, aber "keine elitäre Kunstkirche, sondern eine radikale Banalisierung". Dem werden die angeführten Beispiele allerdings gerecht: "Mit brennenden Füßen auf Eisschollen stehen, / vom Achtstundentag verschont, sich / preisgegeben, das Leben fürchtend / und den Tod, befreundet mit Frisuren." Das ist ganz lustig, wenn es sich nicht beim letzten Wort um einen Druckfehler handelt. Carlos versteht sich im Übrigen auch auf Kurzsätze à la Walser: "Man gleicht sich nicht."
Die Handlung des Romans spielt im Milieu des Münchner Bildungsbürgertums, das bekanntlich mehr als andernorts zur alternativen Freizeitgestaltung von Yoga bis zum Tangotanzen neigt, aber auch zum Mäzenatentum. Ein geeigneter Ort, die Kunst wie sich selbst zu feiern, ist das von Ursula Haeusgen gestiftete Lyrik Kabinett. Das ist angesichts des vielbeklagten Bedeutungsverlusts der Lyrik eine verdienstvolle Institution, gleichwohl ist es nicht schwer, sich über die weihevolle Stimmung bei den Lesungen ein wenig lustig zu machen. Herr Schadt kann dem auch nicht widerstehen, tut aber ganz naiv.
Bei der Preisverleihung an Carlos Kroll stürzt zunächst der betagte Vorsitzende des "Vereins für Gute Dichtung" auf das Podium. Die Laudatio hält dann, "graues Haargefluder um den Kopf, das nie eine Frisur erlebt hatte", ein Literaturprofessor der Münchner Universität. Der weiß zwar offenbar nicht, wann Georges Gedichtband "Das Jahr der Seele" erschienen ist, führt aber aus, dass Carlos Kroll "andauernd seine eigene Existenz in Sprachgesten erlebe, die immer das Ganze, das große Ganze, fassen und ausdrücken wollen". Die Parodie des Jargons der Eigentlichkeit ist ein bisschen billig und kommt auch sechzig Jahre zu spät, aber da außer auf George auch auf Enzensberger und Celan verwiesen wird, ahnt der Leser ein wenig Walsersche Hinterhältigkeit. Der Dichter dankt jedenfalls trocken dafür, dass er "bis zur Verständlichkeit heruntergeredet" worden ist.
Beim anschließenden Diner erklingen dann noch ein paar salbungsvolle Worte, ehe Herrenwitze der schlechteren Art erzählt werden, bei denen sich nicht unerwartet der Literaturprofessor besonders hervortut. Eine Figur aber, der Konsul Danielus, wird von der grobschlächtigen Satire verschont. Der spricht mit Wilhelm Grimm von der "Beweglichkeit der Sprache", in der "doch alle nur mitgeführte Figuren" seien. So könnten die Menschen einander nicht für das Gesagte verantwortlich machen, es habe aber, 1849 in der Paulskirche zu Frankfurt, einen Ort gegeben, an dem "phrasenfrei gesprochen werden konnte".
Das kann man von dem Suizidforum, an dem sich Herr Schadt unter dem Namen Franz von M. - nämlich "Moor" nach Schillers "Kanaille" - beteiligt, eher nicht sagen. Er verliebt sich zunächst in den Begriff "irreversibel", mit dem eine unter "Aster" firmierende Teilnehmerin ihren Entschluss zur Selbsttötung bezeichnet, und dann in die Person, die er sich vorstellt, teilt ihr aber zugleich mit, dass er kein "brauchbarer Mann" mehr ist.
Im Laden für Tangobedarf, den seine Frau Iris betreibt, an der Kasse sitzend, blickt er derweil plötzlich in dunkle Augen "aus einem blendenden Lichtgewoge". Die Augen gehören zu Sina Baldauf, für die Tangotanzen eine "Parallelwelt" darstellt. Mit ihr beginnt er einen ausufernden Briefwechsel, ihr will er nun "andauernd etwas Schönes sagen". Da wird dann Herr Schadt höchstselbst zum Lyriker: "Welt reimt sich auf Sinn, / wie sich Blüte auf Liebe reimt. / Ich fühle, dass in mir / immer etwas keimt." Damit nicht genug der Wesensveränderung, wegen dieser sprichwörtlichen Liebe auf den ersten Blick verlässt er das "schutzreiche Haus" seiner getreuen Ehefrau, der "göttlichen Iris".
Der Briefwechsel mit Sina Baldauf wie der mit "Aster" belegt Niklas Luhmanns Diktum, dass Liebe nicht in erster Linie ein Gefühl ist, sondern ein symbolisch generalisierendes Kommunikationsmedium. Unentwegt schreiben sie sich Schönes, bis sie glauben, dass sie etwas füreinander sind oder gar ohneeinander nicht sein können. Doch dann stellt sich alles, selbst die Eifersucht auf Sinas Tangoerlebnisse, als doppeltes Missverständnis heraus. Da eifert Herr Schadt dem alten Goethe nach und schreibt auch eine "Elegie". Und wie Goethes letzte Liebe zu Ulrike von Levetzow könnte Sina sagen: "Eine Liebschaft war es nicht." Herrn Schadts Version der Entsagung besteht aber darin, dass er nun keinerlei Wirklichkeit mehr dulden will. "Ich bilde mir ein, was ist." Das ist deutscher Idealismus, der die Liebe als schöpferische Kraft feierte, die Erfüllung aber vor allem in schönen Briefen fand. Nicht zufällig gibt es bei der Preisverleihung im Lyrik Kabinett eine Gedenkminute für Karoline von Günderode, die sich am Rheinufer erdolchte, als sie ihre Liebe verraten fand. Auch in "Ein sterbender Mann" sind entsprechend Todesfälle zu beklagen, Herr Schadt aber bleibt am Leben.
Dem Schriftsteller teilt er mit, dass sein Satz "Mehr als schön ist nichts" verbessert werden muss wegen einer, die eben mehr als schön war. "Sie war alles." Das ist aber auch übertrieben. Daher meldet sich zum Schluss der nunmehr "so genannte Schriftsteller" nur noch mit ein paar apart formulierten Binsenweisheiten über das Vergehen der Zeit zu Wort.
In dem Faksimile eines handschriftlichen Briefes an die, "die damit zu tun haben", hat Martin Walser angeregt, den Roman als "Selbstportrait" und als Geschichte von einem zu lesen, der dem Tod nahe ist und dann feststellt, dass es schöner wäre, zu leben. Das ist aber nur eine weitere Finte in Walsers Spiel mit der Autorschaft. Wer eine ironisch-sentimentale Geschichte über die "Niederlage des Alters" erwartet, das Komische wie das Elegische der späten Liebestorheit, wird enttäuscht sein.
Denn "Ein sterbender Mann" ist ein trickreiches Kunststück, in dem Walser mit der Sprache absichtsvoll auch die überladene Konstruktion des Romans scheitern lässt. Der erfahrene Romancier demonstriert, dass er eine Welt aufbauen und wieder zusammenbrechen lassen kann. Das erregt die Bewunderung des Lesers, erreicht aber durch ein Übermaß an bis ins Alberne getriebener Parodie, die an Liebesverrat grenzt, nicht sein Herz.
FRIEDMAR APEL
Martin Walser: "Ein
sterbender Mann". Roman.
Rowohlt Verlag, Reinbek 2016. 288 S., geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Die Wörter sind nun frei für neue Geschichten, neue Romane. Zum Beispiel für diesen herrlich leichten, selbstironischen, tragisch-schönen Roman des Theo-Erfinders Martin Walser. Volker Weidermann Der Spiegel
Klappentext:
Theo Schadt, 72, Firmenchef und auch als „Nebenherschreiber“ erfolgreich, wird verraten. Verraten ausgerechnet von dem Menschen, der ihn nie hätte verraten dürfen: Carlos Kroll, seinem engsten und einzigen Freund seit 19 Jahren, einem Dichter. Beruflich ruiniert, …
Mehr
Klappentext:
Theo Schadt, 72, Firmenchef und auch als „Nebenherschreiber“ erfolgreich, wird verraten. Verraten ausgerechnet von dem Menschen, der ihn nie hätte verraten dürfen: Carlos Kroll, seinem engsten und einzigen Freund seit 19 Jahren, einem Dichter. Beruflich ruiniert, sitzt Theo Schadt jetzt an der Kasse des Tangoladens seiner Ehefrau, in der Schellingstraße in München. Und weil er glaubt, er könne nicht mehr leben, wenn das, was ihm passiert ist, menschenmöglich ist, hat er sich in einem Online-Suizid-Forum angemeldet. Da schreibt man hin, was einem geschehen ist, und kriegt von Menschen Antwort, die Ähnliches erfahren haben. Das gemeinsame Thema: der Freitod. Eines Tages, er wieder an der Kasse, löst eine Kundin bei ihm eine Lichtexplosion aus. Seine Ehefrau glaubt, es sei ein Schlaganfall, aber es waren die Augen dieser Kundin, ihr Blick. Sobald er seine Augen schließt, starrt er in eine Lichtflut, darin sie. Ihre Adresse ist in der Kartei, also schreibt er ihr – jede E-Mail der Hauch einer Weiterlebensillusion. Und nach achtunddreißig Ehejahren zieht er zu Hause aus. Sitte, Anstand, Moral, das gilt ihm nun nichts mehr. Doch dann muss er erfahren, dass sie mit dem, der ihn verraten hat, in einer offenen Beziehung lebt. Ist sein Leben “eine verlorene, nicht zu gewinnende Partie"?
Beim Lesen dieses Buches war ich sehr zwiegespalten. Zum einen war da die, wie ich sie nenne „geschwollene Sprache“, deren Inhalt man oft nicht verstand, zum anderen Interesse und unterschwelliger Humor, der mich doch neugierig machte.
Zitat, Seite 154:
„Er hört sich sprechen. Er hört sich zu. Im Dunkel. Ins Dunkel hinein sagt er, hört er sich sagen: Für sich ist etwas und angerichtet, nicht fremd, aber uneigen und selbst, man muss es begreifen, dann hat man’s , nur brauchbar ist es nicht, du kannst es nicht rufen, es ist nicht es, aber eine Tätigkeit, in der du dich kennst, ich hüpfe wohl, weil mir Boden fehlt. Und dieses seltene Wohlgefühl, dass er das nicht verantworten müsse.“
Was wollte der Autor mit diesem Satz sagen? Ich habe es nicht verstanden.
Es folgten einige verwirrende Abschnitte sowie nichtssagende, unverständliche Gedichte. Dann wiederum war das Thema trotz aller Widersprüche doch interessant und teilweise sogar amüsant, ich blieb am Ball, wollte weiterlesen. Ab Mitte des Buches legte sich auch die „geschwollene Sprache“ etwas, so dass ich mit Interesse weiter dabei war.
Für mich ist die Rezension für dieses Buch eine der Schwersten.
Dies war mein erstes Walser-Buch. Und auch jetzt noch schwanke ich zwischen Zufriedenheit und Kopfschütteln. Wenn mir jemand Briefe, so wie Theo Schadt sie im Buch verfasste, zugesandt hätte, hätte ich mitnichten gedacht, der Verfasser hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. So ein Wirrwarr an Ausdrücken, so eine geschwollene Sprache, so drückt sich doch kein normal Sterblicher aus, habe ich gedacht. Doch Aster antwortete in der gleichen Ausdrucksweise, wo ich dachte, habe ich so wenig Ahnung von gehobener Literatur und deren Ausdruck? Von Lyrik, da ich die Gedichte verwirrend und unverständlich fand?
„Ein sterbender Mann“ ist keine leichte Kost. Ich bin dennoch froh, das Buch zu Ende gelesen zu haben. Denn die anfangs verstörende und verwirrende Geschichte, die Briefe, Aussagen und die Sprache, besserten sich und es fügte sich beim Weiterlesen dann alles zusammen.
Zwiegespalten blieb ich trotzdem zurück, ich fand das Buch zum einen furchtbar, aber kopfschüttelnd las ich trotzdem weiter, und wurde belohnt mit einer Geschichte, die sich zusammenfügte am Ende.
Weniger
Antworten 7 von 7 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 7 von 7 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für