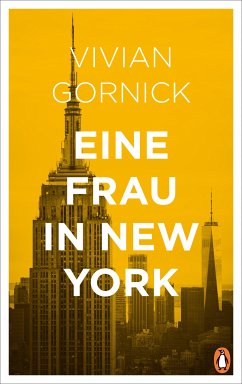»Eine Frau in New York« ist das zutiefst ehrliche Bekenntnis Vivian Gornicks, der Grande Dame der amerikanischen Frauenbewegung, zu einem selbstbestimmten, unkonventionellen Leben, eine mutige Annäherung an das Fremde, eine Ode an wahre Verbundenheit und eine Liebeserklärung an diese kräftezehrende und zugleich so vitalisierende Stadt: New York.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Grenzberichterstattung: Vivian Gornicks Erfahrungsseelenkunde "Eine Frau in New York"
Die amerikanische Schriftstellerin Vivian Gornick ist eine Flaneurin par excellence. Sie streift mit einem derart geschärften Blick für Menschen und Situationen durch Manhattan, als eroberte sie die Stadt, in der sie seit Jahrzehnten lebt, zum ersten Mal. Es sind heilsame Fußmärsche, Therapiestunden ohne Psychiater und ohne Couch, die der 1935 in der Bronx als Tochter jüdischer Einwanderer geborenen Vivian Gornick helfen, sich selbst vom Gefühl der Einsamkeit zu befreien.
Im Gegensatz zu Susan Sontag oder Joan Didion dürfte Vivian Gornick hierzulande einem eher kleinen Publikum bekannt sein, was sich allerdings im vergangenen Jahr zumindest etwas geändert hat. 2019 nämlich erschien ihr als Klassiker der amerikanischen Frauenbewegung geltender, 1987 veröffentlichter Roman "Fierce Attachments" in deutscher Übersetzung unter dem Titel "Ich und meine Mutter". Und nun also, lediglich ein Jahr später, das schmale, autofiktionale Buch "Eine Frau in New York". Und diese Frau, daran besteht bereits nach wenigen Seiten kein Zweifel mehr, braucht "den Beton unter den Füßen" zum Leben. Sobald sich das wie die Summe seiner Beschränkungen anzufühlen beginnt, spaziert Vivian Gornick zum Times Square, wo die "ausgebuffteste Unterschicht der Welt" tapfer ihren täglichen Existenzkampf führt und Vivian Gornicks Blickwinkel korrigiert.
Die Autorin beschreibt sich selbst als eine Frau, die seit jeher sucht: nach Anerkennung, einem elektrisierenden Gesprächspartner, der großen Liebe, dem Gefühl, endlich anzukommen, in sich selbst heimisch zu werden. Und so liest sich Vivian Gornicks Buch stellenweise durchaus selbstkritisch, etwa, wenn es um das "hohe Ross des radikalen Feminismus" geht, auf dem sie einst saß, oder eben um die Liebe: "Wir waren Opfer eines neurotischen Verlangens, wir alle - Dorothea und Isabell, meine Mutter und ich und auch die Märchenprinzessinnen. Das Verlangen faszinierte und forderte unsere ungeteilte Aufmerksamkeit." Mit der Liebe, zumal der romantisch überhöhten, hat es im Leben der Schriftstellerin und Feministin nicht gut funktioniert: Zweimal wurde sie geschieden, zigmal ihrer Träume beraubt. In der Freundschaft und in der Liebe sei die Erwartung als ausdrucksfähiges, wenn nicht gar optimales Ich, in der Gegenwart des Geliebten aufzublühen, der Schlüssel. Alles, so Gornick, konzentriere sich auf dieses Aufblühen. "Aber was, wenn das rastlose, das Fließende, das Unbeständige in jedem von uns genau das untergräbt, was wir uns angeblich am meisten wünschen." Dieses Spiel von Anziehung und Abstoßung führt meistens in eine Sackgasse, aus der man in freundschaftlichen Beziehungen noch eher herausfindet als in der Liebe.
Vivian Gornicks engster Freund ist der homosexuelle Leonard, wobei auch die Verbindung zu ihm natürlich nicht spannungsfrei ist - wie könnte sie auch bei zwei kompliziert gestrickten Charakteren? Dachte Vivian Gornick zu Beginn der Freundschaft noch etwas naiv, ja fordernd, sie und Leonard seien dafür da, den jeweils anderen zu retten, erkannte sie irgendwann, dass sie beide in Wahrheit zwei einsame Reisende sind, "die durch die Landschaft ihres Lebens stolpern und sich gelegentlich an den äußeren Rändern verabreden, um Grenzberichte zu erstatten". Das klingt nüchterner, als es gemeint ist, denn "Eine Frau in New York" liest sich streckenweise wie eine Ode an die Freundschaft.
Dass wir in der Begegnung mit anderen uns selbst entdecken, ist bekannt, aber Vivian Gornick gelingt es in vielen kurzen, plastischen Szenen zu beschreiben, was das im Alltag heißen kann, ob sie nun mit Arthur, der an der Subway-Haltestelle in der Nähe ihres Hauses bettelt, spricht oder einen Mann in der U-Bahn beobachtet, der sich mit seinem behinderten Sohn liebevoll per Zeichensprache unterhält.
Einmal, an einem eisigen Wintermorgen, hilft Vivian Gornick einem alten, klapperdürren Mann heil über Holzplanken, die am Rande einer frisch betonierten Straße ausgelegt worden sind. Eine Sekunde nur, in der sie ihm die Hand reicht, die er nimmt, bevor er sich rasch wieder mit einem "Danke" verabschiedet. Dass dieses "Danke" noch den Rest des Tages durch die Adern der Helfenden strömte, liegt an der Stimme des Mannes, die so gar nicht nach einem Greis klang. Sie war "stark, lebhaft, selbstbeherrscht".
Dieser Mann, schreibt Gornick, hatte verstanden, dass sie eben nicht außergewöhnlich hilfsbereit gewesen war und er sich nicht außergewöhnlich dankbar zeigen musste. "Er rief uns beiden in Erinnerung, dass jeder Mensch, der in Schwierigkeiten gerät, das Recht hat, Hilfe zu erwarten, so wie jeder Zeuge die Verpflichtung, diese Hilfe anzubieten." Doch dazu braucht es offene Augen und ein offenes Herz - von beidem kann es gar nicht genug geben.
MELANIE MÜHL
Vivian Gornick: "Eine Frau in New York".
Aus dem Englischen von Pociao. Penguin Verlag, München 2020. 160 S., geb., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main