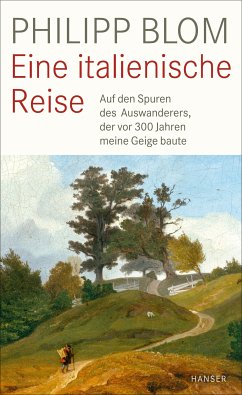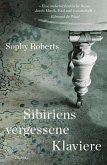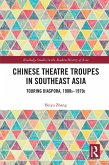Um 1700 machte sich ein Geigenbauer aus dem Allgäu auf den Weg nach Italien. Seinen Namen kennen wir nicht, aber eines seiner Instrumente: gebaut in süddeutscher Tradition, aber vermutlich in Venedig fertiggestellt. Es legt Zeugnis ab von einem Netzwerk, in dem bereits vor mehr als drei Jahrhunderten Menschen, Waren und Wissen durch Europa zirkulierten. Philipp Blom hat diese Geige entdeckt und kommt von ihrem Klang nicht mehr los. Nun hat er ihre Geschichte erforscht. Sie handelt von Migration, von der Lebenswelt der Handwerker, aber auch von Venedig, der damaligen Hauptstadt der Musik. Die Suche nach dem namenlosen Geigenbauer liefert den Schlüssel zu einer ganzen Epoche - die unserer Gegenwart gar nicht so fremd ist.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.