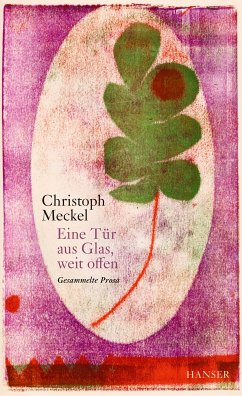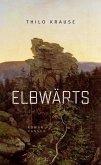Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Wie lebte es sich, wenn man eine Kunstfigur wäre? Die gesammelte Prosa des im Januar verstorbenen Christoph Meckel bildet eine Biographie in Bruchstücken und zeigt den Autor auch als Bildkünstler von Gnaden.
Unter all den Figuren, die Christoph Meckel sich im Laufe seines Lebens ausgedacht hat, ist auch eine, von der es heißt, sie könne mit den Augen denken: "Weiße Wolke denken die Augen von Zünd." Die Geschichte über den Außenseiter namens Zünd, der nicht hat herpassen wollen, wie es an ihrem Ende heißt, nicht hierhin und nicht dorthin, erschien 1964, umfasst knapp zehn Seiten, und wer sie einmal gelesen hat, wird sie wohl nie wieder vergessen.
Meckel hatte ein besonderes Verhältnis zu seinen Figuren, bei denen er zwischen Romanfiguren und Kunstfiguren unterschied. Um es kurz zu machen: Romanfiguren haben ein Leben, Kunstfiguren existieren. Romanfiguren sind in Handlungen verstrickt, sie zahlen Miete oder kaufen ein Haus, gründen eine Familie, lassen sich scheiden, machen Karriere oder scheitern. Für Kunstfiguren gilt all dies nicht. Kunstfiguren sind "angreifbar, aber unverwüstlich", sie sind frei von Geburt und Tod, gesetzlos, nichts und niemandem verpflichtet: "Es ist schon viel, dass sie da sind und nichts bedeuten."
Kunstfiguren sind nach Meckels Geschmack. Manche von ihnen überdauern Jahrhunderte, wie etwa das "bucklicht Männlein", das Clemens Brentano in die Sammlung "Des Knaben Wunderhorn" aufgenommen hat. Walter Benjamin war fasziniert von der Figur dieses rätselhaften, unheimlichen Gnoms, der nur durch das Gebet eines Kindes erlöst werden kann, ohne dass man wüsste, wovon eigentlich, und Christoph Meckel, der immer auch Zeichner und Graphiker war, hat ihm einen Zyklus von zwölf Radierungen gewidmet. Er ist komplett in dem Prosaband Meckels erhalten, der jetzt erschienen ist.
"Eine Tür aus Glas, weit offen" enthält zwei Dutzend Texte aus vier Jahrzehnten, die an den unterschiedlichsten Orten publiziert waren, zum Teil in kleinen Auflagen, im Verlag Ulrich Keicher und in der Edition Isele, in Jahrbüchern oder Zeitschriften. Es sind Aufsätze darunter, Lob- und Dankesreden, Selbstauskünfte, vor allem aber Texte, die sich keiner Gattung zurechnen lassen wollen, die sich sträuben gegen Einordnung und Zuordnung, nicht recht herpassen wollen, nicht hierhin und nicht dorthin. Das ist das Reizvolle an dieser Prosasammlung, und darin erweist sich ihr Rang: Verstreutes, Gelegenheitsarbeiten, denkt man zunächst, aber Meckel hat eine Art, das Beiläufige beim Schopf zu packen, es zum Anlass zu nehmen für Betrachtungen und Erörterungen, die früher oder später immer zu den Glutkernen seines Lebens und Schaffens führen.
Begonnen hat dieses Leben 1935 in Berlin, aber aufgewachsen ist Meckel in Freiburg im Breisgau, wo er am 29. Januar dieses Jahres starb. Die Bombardierung der Freiburger Innenstadt vom November 1944 war ein das Leben prägendes Ereignis. Der über alles geliebte Turm des Münsters blieb zwar wie durch ein Wunder verschont, doch im noch Jahrzehnte später wiederkehrenden Traum begrub der stürzende Turm die Stadt immer wieder aufs Neue unter sich.
Meckels Kindheitslandschaft bestand daher aus Schutt, Schilder an den Ruinen der Häuser verboten den Zutritt und brannten sich ins Gedächtnis ein: "Ich war und blieb in den Trümmern zu Haus." Hier, in den Trümmern, nahm die Lebensform, die Meckel für sich wählte, ihren Ausgang: nicht an die Dauer glaubend, unwillig, wenn nicht unfähig, sich auf einen Lebensort zu beschränken, aber den Mühlstein der deutschen Geschichte und ihrer Verbrechen immer im Reisegepäck mit sich führend. Doch hier, in den Trümmern Freiburgs und der Ortlosigkeit des Heranwachsenden in der Nachkriegszeit, wurzelt auch Meckels Sinn für das Fragmentarische, die Fähigkeit zum Aufbruch, der Glaube an die unendliche Vielfalt des Möglichen: "Ich lebe und atme in dem, was noch nicht gemacht ist."
Er glaubte weniger an die Dauer als an die glückliche Verbindung von Vielfalt und Zufall. Mit "Suchbild - Über meinen Vater" gelang ihm 1980 eine wegweisende Auseinandersetzung mit der Vätergeneration und ihren Verstrickungen im "Dritten Reich", der er 2002 den Band "Suchbild - Über meine Mutter" folgen ließ. Die Gefährdungen, die Einfallsreichtum und Produktivität mit sich bringen können, waren ihm bewusst. Im Essay "Über das Fragmentarische" werden sie angesprochen, wenn Meckel unbarmherzig ein Autorenschicksal entwirft: "Versklavt von Fragmenten, von Varianten umstellt, ruiniert er sein Gehirn an der Schreibmaschine, und bevor er zum Konzentrat seiner Textmassen kommt, ist die Zeit vorbei; ein Nachlass tut sich auf."
Meckel war beides: zart und zu großer Härte bereit. Er war ein ans Erwachen gewöhnter Träumer, ein distanzierter Beobachter und Verächter des Kulturbetriebs, ein Pathetiker der Bescheidenheit und ein stolzer Verfechter der Autonomie des Kunstwerks. Er behauptete sie sogar dessen Schöpfer gegenüber, wenn er selbst dieser Schöpfer war: "Zu meinen Büchern habe ich nichts zu sagen. Das einmal aus Sprache Gemachte gehört sich selbst sowie jedem anderen außer dem Autor. Es braucht von ihm nicht erörtert zu werden." Gelegentlich macht sich wie in diesen Sätzen ein leichter Hang zum Apodiktischen bemerkbar, aber er verschwindet sofort, sobald Meckel nicht über die Sache der Kunst schreibt, sondern über Künstler und andere Menschen.
Er gräbt aus alten Aufzeichnungen Passagen aus, die er in den sechziger Jahren verfasst hat, als er mit Ingeborg Bachmann und dem Maler und Grafiker Günter Schöllkopf durchs nächtliche Rom zog. "Schöllkopf - Ein Gruß" ist ein kleiner Bilderbogen von Reminiszenzen aus einer Zeit, als das Künstlertum gar nicht so selten unheilvolle, sogar todbringende Formen annehmen konnte. Ein Unglück verheißender Hang zum Absoluten, der unbedingte Wille zur Beglaubigung der eigenen Positionen, und sei es durch sukzessive Selbstzerstörung, maßloser Genuss von Alkohol und anderen Drogen, es kam manches zusammen. Schöllkopf starb 1979 im Alter von 44 Jahren und hinterließ etwa tausend Werke. Aus Meckels Notizen von 1966: "Ein Mensch, der andere ins Unrecht setzen muss, um zu existieren. - Er ist originell, kann gut erzählen, bekommt aber Anfälle, ich mag ihn gern, er leidet halt." Meckel ist ein guter Beobachter, mitfühlend, sensibel, aber nie rührselig. Mitleid ist etwas, was ein Künstler haben soll, aber nicht erregen darf.
Kann man über einen Menschen schreiben? Meckel stellt die Frage zu Beginn seiner "Sieben Blätter für Monsieur Bernstein". Darin berichtet er von der zufälligen Begegnung mit einem Juden, den es wie Meckel in ein französisches Dorf im Süden verschlagen hat. Man lernt sich kennen, freundet sich an. Bernstein, der in der Eifel geboren wurde, erzählt, wie es ihm in den deutschen Konzentrationslagern ergangen ist. Meckel berichtet, gibt weiter, was er hört. Er wird zum Zeugen des Zeugen des Holocausts. Man sollte diesen Text zusammen mit seiner Würdigung von Jean Améry und dessen Biographin Irène Heidelberger-Leonhard lesen, um einen Eindruck davon zu bekommen, auf welchen Wegen sich Meckel um ein Verständnis des Unbeschreiblichen und seiner nicht endenden Folgen bemüht hat.
Meckel hat die Auswahl der Texte für diesen Band noch selbst autorisiert. Er muss gewusst haben, dass er dem Leser damit auch eine Biographie in Bruchstücken an die Hand gibt. Man setzt die verstreuten Mosaiksteinchen, darunter gewiss nicht zufällig der große Essay "Über das Fragmentarische", während der Lektüre unwillkürlich zusammen und erhält am Ende ein Bild des Dichters und Zeichners, unvollständig, aber prägnant. Meckel zeigt etwas von sich. Er zeigt sich in jedem dieser Texte: frei, angreifbar, aber unverwüstlich. Ob er selbst gern eine Kunstfigur gewesen wäre? Manchmal gefiel es ihm wohl, so zu leben, als wäre er eine.
HUBERT SPIEGEL.
Christoph Meckel: "Eine Tür aus Glas, weit offen".
Gesammelte Prosa.
Hanser Verlag, München 2020. 256 S., Abb., geb., 25,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Dlf-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH