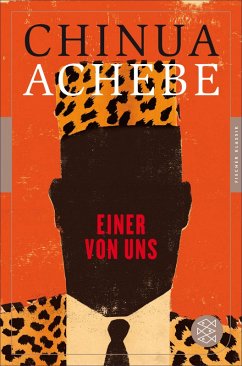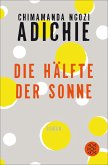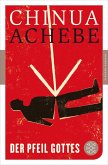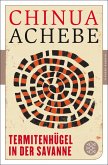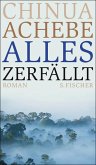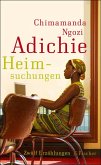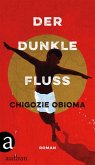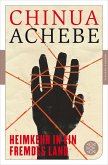Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

© BÜCHERmagazin, Anna Gielas
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Erstmals erscheint der wichtigste Roman des hochdekorierten Nigerianers Chinua Achebe auf Deutsch: "Einer von uns" handelt von Machtopportunismus und Dissidentenstolz.
Die Buchmesse beginnt. Alles, was Rang und Namen hat oder einfach sich nur dazuzählt, strömt zur feierlichen Eröffnungsgala. Diplomaten sind gekommen, internationale Fachbesucher und sogar ein paar Autoren. Denn das offizielle Grußwort spricht der Kulturminister selbst, auch wenn dieser, wie er freimütig erklärt, bislang noch nie etwas von der Veranstaltung gehört hat. Bücher und Lektüre zählen nämlich nicht zu seinen Hauptinteressen. Die anwesenden Schriftsteller sind ihm daher gänzlich unbekannt. Doch sobald er auf dem Podium und am Mikrofon steht, ist Minister Nanga, ganz Staatsmann und Volksfreund, voll des Lobes für die großen Leistungen der Literaten, mit denen sie die Landeskultur hinaus in die Welt tragen. Dabei hält er den Präsidenten ihres Verbandes, wie ihm ein Begleiter noch kurz zuraunt, Autor des gefeierten Romans "Der Gesang der Schwarzdrossel", für einen Musiker und Sänger. Wir sind auf der Buchmesse von Bori, Hauptstadt des fiktiven afrikanischen Staats, in dem Chinua Achebe seinen vierten Roman ansiedelt.
Unschwer erkennt man darin das Nigeria der frühen sechziger Jahre, ein Land, das sich nach dem ersten großen Höhenflug der Unabhängigkeitsbewegung, die alle wie in einem wunderbaren Rausch zusammenführte und eine Zeitlang forttrug, mittlerweile längst am Boden eines grauen Alltags wiederfindet. Die hehren Vorsätze und Freiheitsideale sind wohl noch in Erinnerung, aber taugen nur für Fest- und Wahlkampfreden. Vorrangig hat jeder ausreichend damit zu tun, das eigene Fortkommen und Überleben in die Hand zu nehmen. Korruption und Vorteilsannahme sind dazu probate Mittel, weshalb sich auch brüskierte Würdenträger wie der besagte Schriftstellerpräsident mit einem mächtigen Minister lieber arrangieren. Es kommt hier eben alles darauf an, wen man kennt, nicht, was man kann. Und bessere Gelegenheit, Bekanntschaften zu schließen, als die Buchmesse gibt es so schnell nicht wieder. Davon erzählt uns hier ein Teilhaber der neuen Günstlings- und Gelegenheitsgesellschaft, ein junger Lehrer namens Odili, der seine beruflichen wie erotischen Interessen gleichermaßen effizient zu pflegen weiß. In der Hauptstadt hält er sich als persönlicher Gast und Protegé des Kulturministers auf, dessen ungebildetes Gebaren er zutiefst verachtet und dennoch als politisch opportune Maßnahme erkennen muss. Zum Bruch und Konflikt kommt es allerdings, als Minister Nanga ihm eine aktuelle Liebhaberin ausspannt. Nunmehr setzt Odili alles daran, dem vormaligen Gönner zuzusetzen und ihn politisch wie persönlich nach Kräften zu demütigen. Das Duell der ungleichen Rivalen, das sich immer bizarrer ausweitet, eskaliert und gerät zum Schluss in einen Sog politischer Gewalt. Ob dies nur die weitere Drehung einer sinnlosen Spirale ist oder doch zum Durchbruch einer neuen Ordnung führt, bleibt offen.
Drei Romane, thematisch eng verknüpft, hatte Chinua Achebe (1930 bis 2013) bereits herausgebracht - darunter sein Debüt "Things Fall Apart" (1958), das ihn über Nacht zur Gründungsfigur der modernen afrikanischen Literatur machte -, als er 1966 mit "A Man of the People" einen deutlichen Sujet- und Strategiewechsel vornahm. Galt sein erzählerisches Interesse bisher der historischen Erkundung lokaler Gesellschaften im Umgang mit Kolonialautoritäten und deren Auswirkungen bis zur Gegenwart, wählte er für seinen vierten Roman eine klar präsentische Perspektive auf Macht- und Männerspiele in der postkolonialen Wirklichkeit, um sie zugleich ins Parabelhafte eines fiktiven Staatwesens zu entrücken. Sein unbestechlich scharfer Blick erkannte dabei offensichtlich sehr genau - nachgerade prophetisch -, was in seinem Land geschah. Der Roman endet mit einem Putsch, und tatsächlich putschte in Nigeria die Armee kurz nach Erscheinen. Diese literarische Vorwegnahme politischer Ereignisse machte den Autor selbst in hohem Maß verdächtig, in die Umsturzpläne eingeweiht zu sein, und zog ihn in den Strudel der gewaltsamen Konflikte, die das Land seither bestimmen.
Solche zeit- und ortsgebundenen Aspekte sind vermutlich auch ein Grund, warum es ganze fünfzig Jahre gedauert hat, bis dieses Schlüsselwerk eines Autors, der 2002 mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt wurde, erstmals überhaupt in deutscher Übersetzung erscheint. Ein anderer Grund ist gewiss die komplexe sprachliche Gestaltung vieler Dialogpassagen, die im Original nicht nur auf Englisch, sondern auch im nigerianischen Pidgin erscheinen, für das es im Deutschen kein passendes Pendant gibt. Das Problem stellt sich bei vielen afrikanischen Romanen: Pidgin ist kein fehlerhaftes Englisch, sondern ein regulärer Kode der informellen und vertrauten (oder auch anbiedernd vertraulichen) Rede in einer vielsprachigen Alltagskommunikation. Wenn frühere Übersetzer es daher versuchsweise mit Dialekten wie Berlinerisch oder Kölsch wiedergegeben haben, dann rufen sie ganz falsche kulturelle Assoziationen auf.
Uda Strätling, die vor vier Jahren bereits Achebes Debüt eine starke Neufassung gegeben hat, wählt ein anderes Verfahren: Sie durchsetzt die Dialoge mit den Pidgin-Ausdrücken des Originals, teils mit deutscher Paraphrase, teils auch ohne, und überlässt es uns, alles Weitere aus dem Kontext zu erschließen. Das klingt dann beispielsweise so: "Aber ich bin Kulturminister, also muss ich hin. I no fit say no - ich kann ja schlecht nein sagen. Was ist schon ein Minister anderes als jedermanns Fußball? Also muss ich, statt mich hübsch gemütlich zu Hause hinsetzen zu können, sidon rest, wie andere Leute, an diesem heißen Nachmittag geschwollen daherreden - I de go knack grammar. Ich hab's wirklich schwer." Das ist für Leser nicht immer ganz einfach, aber als übersetzerische Entscheidung so mutig wie plausibel. Warum sonst liest man fremdsprachige Literatur, wenn man nicht deren Eigenart auch sprachlich spüren können will?
Überhaupt gewinnt bei der Lektüre dieses Zeitromans fünf Jahrzehnte nach der Erstveröffentlichung manches an Gewicht, was seinerzeit gar nicht gesehen wurde. Statt der dominanten Titelfigur des Ministers Nanga wirkt heute die Erzählfigur Odili ungleich interessanter: ein schwankender Intellektueller zwischen Machtopportunismus und gekränktem Dissidentenstolz, der seinen Ort in einer strauchelnden Gesellschaft sucht. Und so lässt sich auch der Titel, den die deutsche Fassung trägt, am besten wohl als Frage auffassen, der dieser Roman unerbittlich nachgeht: Wie kommt es, dass uns jemand als "einer von uns" glaubhaft wird? Nicht nur in Wahlkampfzeiten hängt sehr viel davon ab.
TOBIAS DÖRING
Chinua Achebe: "Einer von uns". Roman.
Aus dem Englischen von Uda Strätling. Fischer Klassik, Frankfurt am Main 2016. 186 S., geb., 19,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main