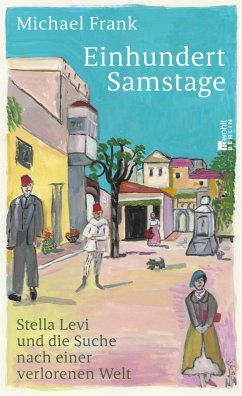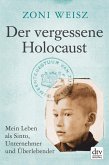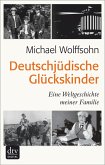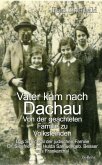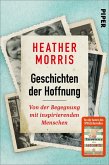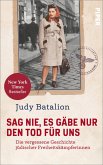Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Die Schoa erreichte auch die jüdischen Gemeinden an Europas Peripherie: Stella Levi erzählt ihr Leben
Rhodos hat eine bewegte Geschichte, immer wieder wurde die griechische Insel erobert: Auf die Römer und andere folgten Jahrhunderte unter osmanischer Herrschaft, bevor 1912 die Italiener das Eiland übernahmen. Erst 1943 wurden diese von den Deutschen gewaltsam ersetzt. Nur zwei Jahre dauerte die Besetzung durch die Nazi-Truppen, doch sie reichten aus, um die kleine jüdische Gemeinde (mit Unterbrechungen womöglich seit vorbiblischer Zeit hier ansässig) nahezu vollständig auszulöschen. Nichts blieb von der bunten Welt der "Juderia", wie der Wohnbezirk genannt wurde, der mit seinen Gebräuchen und Geschichten, unverwechselbaren Gerüchen und Geräuschen einen ganz eigenen Kosmos bildete. Noch bis weit ins dritte Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts war das Leben hier geprägt von jüdischen Riten, aber auch absonderlichen Kuren: "Bei Symptomen, die mit dem bösen Blick (oju malo auf Judäo-Spanisch) in Verbindung gebracht werden, [...] sollte man einen blauen Stein oder eine blaue Perle tragen. Oder beim Urinieren eine Handvoll Salz in die Toilette werfen."
In diese Welt wird 1923 Stella Levi hineingeboren, eine der wenigen, die heute noch von ihr erzählen können. An einhundert Samstagen hat sie dem Schriftsteller und Publizisten Michael Frank ("The Mighty Franks") von ihren Erinnerungen berichtet: von den vielen Traditionen und Ritualen, die Sicherheit gaben, aber auch von der Enge der Gemeinde, aus der die junge Stella ausbrechen wollte. Levi erzählt von der Moderne, die den Fluss des Lebens, wie er in der Juderia so lange ruhig dahinfloss, mächtig aufzuwirbeln begann. Für viele Jüngere wurde die Verbindung zum jüdischen Ritus dadurch immer schwächer, doch eröffneten sich gleichzeitig neue Möglichkeiten. Stellas Mutter hatte zum Beispiel nichts dagegen, dass sich ihre Tochter mit gleich drei Männern regelmäßig traf und ihnen ganz offensichtlich den Kopf verdrehte.
Natürlich berichtet Stella Michael Frank auch von der großen Katastrophe, die alles endgültig veränderte, von der Deportation, die für die "Rhodeslis", wie sie sich selbst nannten, am 16. August 1944 in Auschwitz endete. Noch heute wundert sich Stella Levi über die tödliche Absurdität dieser Verschleppung: "Warum nahmen sie wegen einer so kleinen Gemeinde den weiten Weg auf sich, und dann noch in letzter Minute, zwei Monate bevor Griechenland befreit wurde, um was zu tun? Im Wesentlichen, um Alte zu deportieren. Worin lag der Sinn, über 1700 Menschen zusammenzutreiben, sie auf eine Reise zu schicken, die einen Monat dauerte und wer weiß wie viel kostete?"
Sie hat eine Vermutung: "Manchmal denke ich, dass es [...] vielleicht gar nicht mehr um den Hass auf die Juden ging. Die Deutschen hatten eine Maschinerie aufgebaut und benutzen sie weiter, obwohl sie wussten, dass der Krieg vorbei war." Diese Mordmaschinerie überlebten Stella und ihre Schwester Renée, mit der sie die ganze Leidenszeit zusammenbleiben konnte, nur mit Glück, aber auch mithilfe der Fähigkeit, sich psychisch abzuspalten: "Ich löste mich von der Stella, die in Auschwitz war. Es schien, als würde alles, was ihr widerfuhr, einer anderen Stella widerfahren, nicht der Stella, die ich war, nicht der Stella aus Rhodos, der Stella, die ich kannte."
Einem Todesmarsch aus Birkenau folgten weitere Lagererfahrungen, ehe die Schwestern befreit wurden. Sie beschlossen, nicht nach Rhodos zurückzukehren - was oder wen hätten sie dort finden können? -, sondern nach Amerika zu gehen, wohin ein Teil ihrer Familie schon vor der Katastrophe hatte auswandern können. Dort begann Stella viel und brach es wieder ab, wurde Mutter eines Sohnes, den sie aber nach der Trennung von ihrem Ehemann nur noch selten sah: "Ich glaube, für ihn war es so am besten." Erst spät fühlte sie sich zur Zeitzeugin berufen und musste auch von Michael Frank zu dem gemeinsamen Buchprojekt überredet werden.
"Einhundert Samstage", das literarische Protokoll ihrer vielen Gespräche, ist freilich nicht nur eine Erzählung über Stella Levis Leben und eine "verlorene Welt", wie es im Untertitel heißt, es ist auch ein Buch über die Kraft des Erzählens selbst: "Stella ist eine unheimliche und zugleich clevere Scheherazade. Sie versteht es, mich hängen zu lassen, Woche für Woche, Moment für Moment, Satz für Satz. [...] Meistens ist es interessanter, abzuwarten und zu sehen, was sie mir - auf ihre Weise - erzählen will." Nicht nur für den Zuhörer (und Leser) hat diese Erzählweise eine ungeheure Wirkung, Stella hat tatsächlich etwas von der Überlebenskünstlerin aus "Tausendundeine Nacht": "Nun, unsere Gespräche, irgendwie haben sie mich am Leben gehalten", lässt sie ihren Chronisten am Ende wissen. SASCHA FEUCHERT
Michael Frank: "Einhundert Samstage". Stella Levi und die Suche nach einer verlorenen Welt.
Aus dem Englischen von Brigitte Jakobeit. Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2023. 335 S., geb., 24,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH