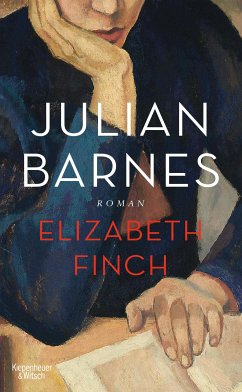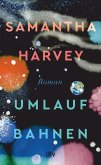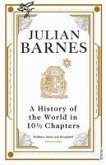Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Fast eine Liebesgeschichte und beinahe ein Epochenbild: Julian Barnes' Roman "Elizabeth Finch"
Ist dieses Buch wirklich ein Roman? Vielleicht kommt man ihm am ehesten nahe, wenn man es als eine Hommage betrachtet. Neil, ein Mann vorgerückten Alters - er hat graue Haare und zwei gescheiterte Ehen hinter sich -, erinnert sich an die Frau, bei der er vor Jahrzehnten - nach der ersten Ehe und einer missglückten Karriere als Schauspieler - ein Erwachsenenseminar über "Kultur und Zivilisation" belegt hat. Gleich auf der ersten Seite des Buchs hat sie ihren Auftritt. Sie tritt ans Pult, kündigt den Zuhörern an, sie werde sie "nicht mit Fakten vollstopfen wie eine Gans mit Mais", erwarte aber "Rigorosität" und nennt ihren Namen: Elizabeth Finch.
Dann folgt, was in einem Theaterstück als längere Regieanweisung gelten könnte. Mrs. Finch trägt feste Halbschuhe zu gestreiften Seidenblusen und knielangen Röcken, "im Sommer mit Kellerfalte, gewöhnlich marineblau, im Winter Tweed". Sie raucht. Sie hat Migräne. Ihre Sprache ist förmlich, ihr Satzbau grammatisch perfekt. Und - hier geht die Beschreibung in Handlung über - sie liebt es, Mythen zu dekonstruieren. Religiöse Mythen, Nationalmythen, Mythen des Alltags. Die elftausend Jungfrauen der heiligen Ursula? Es waren wohl nur elf. Die historische Menschheitsmission der Briten? In Amerika hielten sie länger Sklaven als die Amerikaner selbst. Am heftigsten hadert Elizabeth Finch mit der Sexualmoral des Christentums. "Monotheismus, Monogamie, Monotonie" bilden für sie die unheilige Trias der Lebensfeindlichkeit.
Die meisten Seminarteilnehmer sind von Elizabeth Finchs Unterricht eher moderat begeistert. Anders Neil: Er bleibt seiner Dozentin auch nach dem Ende des Zweitstudiums treu. Jedes Jahr trifft er sich zwei-, dreimal mit ihr in einem Restaurant, und sie reden über die Dinge des Lebens. Irgendwann muss Mrs. Finch die Treffen aus Krankheitsgründen absagen. Kurz darauf ist sie tot. Nach ihrer Beerdigung erfährt Neil, dass er ihre Papiere und ihre Bibliothek geerbt hat, und lernt ihren Bruder Christopher kennen, einen rundlichen weißhaarigen Mann, der ebenso durchschnittlich ist wie er selbst. Dann liest er die Notizen der Verstorbenen.
Inzwischen sind fast hundert Seiten vergangen, und man rätselt noch immer, worauf Julian Barnes mit dieser Geschichte hinauswill. In "Der Mann im roten Rock", dem Buch, das vor "Elizabeth Finch" erschienen ist, hat Barnes eine historische Figur, den französischen Frauenarzt Samuel Pozzi, dazu benutzt, mit eleganter Leichtigkeit das Porträt eines Zeitalters zu skizzieren. Davor hat er in "Die einzige Geschichte" ebenso virtuos die Liebesbeziehung zwischen einem jüngeren Mann und einer älteren Frau geschildert. "Elizabeth Finch" enthält Elemente aus beiden Büchern, ohne sie erzählerisch zwingend zu verbinden. Der frisch geschiedene Neil schwärmt, wie seine Freundin Anna rasch errät, nicht nur rein intellektuell für seine Geschichtslehrerin, aber eine Beziehung entsteht dennoch nicht daraus. Dafür ergibt sich aus den Aufzeichnungen, die Elizabeth Finch hinterlassen hat, ein Schreibprojekt, aus dem durchaus ein Epochenbild aus weit entfernten Zeiten hätte werden können. Doch bei ihrem Schüler Neil reicht es nur zu einem Essay.
Der füllt den Mittelteil des Buches. Es geht um Julian Apostata, den letzten heidnischen Kaiser des Römischen Reiches, und wenn man weiß, dass die frühen Christen in dem Toleranzpolitiker Julian den gefährlichsten Feind ihres Glaubens sahen, ist man schon mitten in der Gedankenwelt von Elizabeth Finch. Der Kaiser, der im Jahr 363 auf einem Feldzug gegen die Perser starb, wollte die alten lokalen Kulte in ein universales synkretistisches Glaubenssystem einbinden und so den Wahrheitsanspruch des Christentums aus dem Feld schlagen. Montaigne, Voltaire, Gibbon und Ibsen haben Julian gepriesen, Swinburne hat ihm ein berühmtes Klagegedicht gewidmet, und selbst Hitler bramarbasierte in seinem Hauptquartier über den Apostaten, dessen antike Weisheit man "in Millionen verbreiten" müsse.
Dies alles und viele weitere Lese- und Gedankenfrüchte hält Barnes' Erzähler auf knapp sechzig Seiten fest. Das Problem ist, dass in dieser Zeit die Geschichte von Neil und Elizabeth Finch gleichsam stillsteht. Als sie im dritten Teil des Buches wieder einsetzt, wirkt sie wie ein Nachtrag zu dem vollendeten Liebeswerk des Julian-Aufsatzes. Noch einmal erhebt sich ein Hauch erzählerischer Spannung, als Neil zu Anna reist, die inzwischen in einer holländischen Kleinstadt lebt, um Erinnerungen an das Seminar auszutauschen und womöglich alte Leidenschaften aufzuwärmen. Aber aus der Asche des Lebens steigt keine Glut mehr auf, und auch die Spur eines Liebhabers, mit dem Christopher Finch seine Schwester einmal am Bahnhof gesehen haben will, endet im Nichts. Zuletzt erfahren wir noch, dass Elizabeth einmal Opfer einer Pressekampagne wurde, nachdem sie in einem öffentlichen Vortrag heidnische und christliche Körpervorstellungen miteinander verglichen hatte.
Das ist so unglaubwürdig, dass es schon fast wieder Stoff für eine eigene Erzählung böte. Vor allem aber zeigt es, wie verzweifelt sich der Autor Barnes darum bemüht, seine Heldin für den Leser interessant zu machen. Doch es gelingt nicht. Elizabeth Finch ist eben kein Flaubert, und der brave Neil ist mindestens zwei Nummern kleiner als der Landarzt Geoffrey Braithwaite aus Julian Barnes' berühmtestem Roman.
Am Ende seines Julian-Essays gesteht der Erzähler ein, er sei in den Romanen von Michel Butor und Gore Vidal über den spätrömischen Kaiser leider nicht weit gekommen. Im Fall von Vidals "Julian" muss man diese Lesefaulheit bedauern. Denn bei dem Amerikaner, der sein 1962 erschienenes Geschichtspanorama als Briefwechsel zwischen dem syrischen Rhetor Libanios und dem athenischen Philosophen Priskos angelegt hat, hätten Neil und sein Autor erfahren können, wie ein moderner historischer Roman aussehen kann. Es ist das Buch, das "Elizabeth Finch" nicht geworden ist. ANDREAS KILB
Julian Barnes: "Elizabeth Finch". Roman.
Aus dem Englischen von Gertraude Krueger. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2022. 240 S., geb., 24,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
unfertiger Projekte
Ein ehemaliger Student versucht, das Lebenswerk
seiner verehrten Lehrerin zu vollenden.
Doch Julian Barnes’ Roman „Elizabeth Finch“
wirkt auch selbst etwas unausgegoren
VON LOTHAR MÜLLER
Es ist eine markante Entscheidung, wenn ein Autor die Titelheldin seines Romans schon nach kaum mehr als fünfzig Seiten sterben lässt. So ergeht es Elizabeth Finch. Der englische Schriftsteller Julian Barnes, der sie erfunden hat, steht zu Recht im Ruf, bei seinen erzählerischen Manövern sehr genau zu wissen, was er tut. Mitten aus dem Leben gerissen hat er die Universitätsdozentin nicht, sie war längst emeritiert, als sie rasch einer Krankheit erlag.
An einem ihrer Seminare für Erwachsene zum Thema „Kultur und Zivilisation“ hat vor Jahrzehnten der Ich-Erzähler des Romans teilgenommen, Neil, ehemaliger Schauspieler und Drehbuchautor, der nach dem frühen Ende seiner Karriere als Nebendarsteller in TV-Serien in die Gastronomie wechselte, später Oldtimer poliert hat und gelegentlich auf seine zwei gescheiterten Ehen zurückblickt.
Von Beginn an erzählt er von einer Toten, alles, was wir über Elizabeth Finch wissen, verdanken wir ihm, etwa, dass sie Genussraucherin und sehr konventionell gekleidet war („Im Sommer ein Rock mit Kellerfalte, gewöhnlich marineblau, im Winter Tweed“), aber auch die Titel der beiden Bücher in ihrer schmalen Publikationsliste: „Explosive Frauen über Londoner Anarchistinnen zwischen 1890 und 1910 und Unsere notwendigen Mythen über Nationalismus, Religion und Familie.“
Nicht das Bücherschreiben steht im Zentrum ihrer intellektuellen Existenz, sondern die mündliche Lehre („Sie stand vor uns ohne Notizen“), die En passant-Produktion aphoristisch zugespitzter Sentenzen, der Dialog mit ihren Zuhörern. Sie zitiert den stoischen Philosophen Epiktet und hat ein dezidiert kritisches Verhältnis zur englischen Nation wie zum Christentum.
Die Heiligengeschichten der mittelalterlichen „Legenda Aurea“ legt sie ins Säurebad der historisch-quellenkritischen Skepsis, beim Thema „Die Sklaverei und ihre Abschaffung“ stellt sie klar, „dass die Briten auf dem amerikanischen Kontinent fast doppelt so lange Sklaven hielten wie die Amerikaner“, das Leitmotiv ihrer Lehre ist die Warnung vor dem Präfix „Mono“. Allenfalls Monografien lässt sie gelten. Alle Monokulturen einschließlich der verordneten Monogamie, vor allem aber den Monotheismus unterwirft sie einer vernichtenden Kritik.
Diese Lehrerin eines Typs, den er in seiner Schulzeit nicht kannte, hat Neil über das Seminar hinaus in ihren Bann geschlagen, zwei – bis dreimal im Jahr hat er sich mit ihr getroffen, bis zu ihrem Tod. In ihrem Testament hat sie ihm alle ihre Papiere und ihre Bibliothek vermacht. Er liest ihre Notizen, erwägt eine Publikation, trägt sich mit dem Gedanken, ein biografisches Porträt über sie zu schreiben. Eine seiner Töchter hat Neil einmal den „König der unvollendeten Projekte“ genannt. Sie wird, was die Biografie betrifft, recht behalten.
Aber Neil hat in den Notizen von Elizabeth Finch eine Figur wiedergefunden, die schon in ihrem Seminar eine Schlüsselrolle spielte: den römischen Kaiser Flavius Claudius Julianus (331-363), „Julian Apostata“, der vom Christentum abfiel, ihm den Kampf ansagte, nicht weniger vorhatte, als die Konstantinische Wende rückgängig zu machen und den Tempel in Jerusalem wiederaufzubauen, der seine scharfe Kritik des Christentums aber mit Toleranz gegenüber den Christen statt mit einer neuen Christenverfolgung verband. Den zweiten Teil seines Romans füllt Barnes mit dem Essay, den Neil über Julian Apostata schreibt, weil er diesen Auftrag aus dem Nachlass der Lehrerin herausliest.
Von Beginn an gehören zum Werk von Julian Barnes Essays über vergangene und gegenwärtige Literatur, die Bibliomanie seiner frühen Jahre, über ihm wichtige Kolleginnen wie Penelope Fitzgerald oder Anita Brookner oder seine Erfahrungen mit der bildenden Kunst. Ein ganzes Buch, „Nichts, was man fürchten müsste“ (2008, dt. 2010) hat er der Frage nach dem Vorschein des eigenen Todes im Leben gewidmet und darin sehr viel über seine eigene Biografie erzählt. Reflexionen, essayistische Abschweifungen tragen zum Reiz seiner Romane bei. Elizabeth Finch entstammt dieser Energiequelle seines Schreibens. Sie mag eine ältere Dame gewesen sein, als sie starb. Im Werk ihres Autors war sie eine sehr junge Figur. Durch ihren Tod nach gerademal fünfzig Seiten hat Barnes sich gegen die Option entschieden, sie zu einem britischen Gegenüber der australischen Schriftstellerin Elizabeth Costello zu entwickeln, die der aus Südafrika stammende, seit langem in Australien lebende Autor John M. Coetzee, Literaturnobelpreisträger des Jahres 2003 am Ende des vergangenen Jahrhunderts erfunden und in einer Reihe essayistischer Erzählungen zu einer Figur der intellektuellen Herausforderung und Zuspitzung, der skandalösen Rede über Tierversuche und den Holocaust, die säkulare Moderne und das postkoloniale Zeitalter, und nicht zuletzt des Nachdenkens über die Literatur gemacht hat.
Die Entscheidung für den frühen Tod von Elizabeth Finch hat die Konsequenz, dass nicht ihre Stimme, sondern die ihres Schülers Neil den Roman von Julian Barnes dominiert. Das verleiht ihm den Charakter eines Nekrologs, der das Gebot, über die Toten nur Gutes zu sagen, gerne erfüllt. Nun wäre aber Barnes nicht Barnes, wenn es damit sein Bewenden hätte. Er hat Neil zu einem Wiedergänger der zahlreichen alternden Männer gemacht, die in seinen Romanen auf ihr Leben zurückblicken und dabei wenige Wahrheiten und viele Lebenslügen zutage fördern.
Zu ihnen gehört zum Beispiel Adrian Finn, der Ich-Erzähler im Booker-Prize-gekrönten Roman „Vom Ende einer Geschichte“. Für diese alternden Männer gilt im Barnes-Kosmos die Verpflichtung zum Mittelmaß. Ihr Autor legt es darauf an, ihre Mediokrität durch die Suggestion einer kunstvoll angedeuteten Rückseite ihrer Existenz auszugleichen, in der es steil hinabgeht in veritable Abgründe.
In diesem Roman gelingt das nur in Ansätzen. Neil lockert seinen Julian-Apostata-Essay, den das Aroma der Auszüge aus Lexika und Biografien umweht, durch gelegentliche Flapsigkeiten auf. Aber dabei bleibt es. Er lernt im älteren Bruder von Elizabeth Finch jemanden kennen, der ihre energische Intelligenz eher leidvoll erfahren hat, aber auch zwischen den Zeilen wird daraus keine dunkle Gegenspur. Neils hartnäckige Versuche, einen durch die Erinnerung ihres Bruders geisternden Liebhaber seines Idols dingfest zu machen, lassen erkennen, dass sein Interesse an Elizabeth Finch in der Ehrfurcht vor ihrer Brillanz nicht aufgeht. „Ich möchte behaupten, dass Scheitern uns mehr lehren kann als Erfolg und ein schlechter Verlierer mehr als ein guter“, lehrt die Dozentin. Neil apportiert diese Einsicht, die sich bis in moderne Managerkurse herumgesprochen hat, als Beleg ihrer Originalität. Der säkularen Heiligenlegende, die er schreibt, fehlen die monströsen Züge.
Er blickt auf eine Affäre mit einer Mitstudentin im Finch-Seminar zurück und versucht im dritten Teil des Romans unschlüssig, sie zu reaktivieren. Aber das verflattert wie die Porträts der anderen Mitstudenten. Früh lässt Barnes in einer Seminarsitzung über Hitler und den Zweiten Weltkrieg die Frage aufkommen, ob Elizabeth Finch womöglich jüdischer Herkunft ist. Im dritten Teil, in dem Neil nach seinem Apostata-Essay die biografische Recherche fortsetzt, wird sie aufgegriffen, bleibt aber ein erzählerischer Blindgänger. Nicht anders steht es um den Skandal, in den Elizabeth Finch gerät, als die Boulevardpresse in einem Sommerloch ihre Christentumskritik an den Pranger stellt.
In seinem letzten Roman „Der Mann im roten Rock“ hat Julian Barnes im Blick auf das Personal der ästhetischen und wissenschaftlichen Avantgarde im England und Frankreich des späten 19. Jahrhunderts ein Kaleidoskop der Obsessionen entfaltet und dabei weder auf die Grenzen zwischen „Fiction“ und „Non-Fiction“ noch auf die Gesetze des literarischen Realismus Rücksicht genommen. Dieser Roman hat demgegenüber etwas Unausgeführtes, Unausgeschöpftes. An der Grundidee, Gedanken, Theorien und Glaubensinhalte figürliche Existenz gewinnen zu lassen, liegt es nicht. Es liegt an der Disproportion zwischen dem Entwurf der Titelheldin und der erzählerischen Konventionalität ihres Schülers und Nekrologen Neil, dem Barnes allzu wenig Doppelbödigkeit zugebilligt hat.
Es gibt ein Missverhältnis
zwischen der Heldin und der
Konventionalität des Erzählers
Julian Barnes: Elizabeth Finch. Übersetzt von
Gertraude Krueger.
Kiepenheuer & Witsch 2022.
240 Seiten. 24 Euro.
Heimliche Hauptfigur: der römische Kaiser Julian.
Foto: IMAGO/AGB Photo
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de