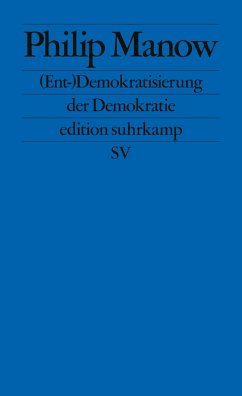Demokratie gegen Demokratie - illiberale gegen liberale, direkte gegen repräsentative Demokratie, vielleicht sogar »the people vs. democracy«? Es scheint, die Demokratie war noch nie so unumstritten wie heute, während zugleich noch nie so umstritten war, was aus ihr folgt. Jeder tritt in ihrem Namen an und beschuldigt den Gegner, ein Gegner der Demokratie zu sein.
Der Demokratie droht heute nur noch Gefahr von ihr selbst. Unsere Lage, so die These Philip Manows, ist von der gleichzeitigen Demokratisierung und Ent-Demokratisierung der Demokratie gekennzeichnet: Es ist die drastische Ausweitung von Partizipationschancen, die im Zentrum der Krise politischer Repräsentation steht. Diese Krise aber transformiert den Streit in der Demokratie zu einem Streit über die Demokratie - der ist jedoch demokratisch nicht zu führen.
Der Demokratie droht heute nur noch Gefahr von ihr selbst. Unsere Lage, so die These Philip Manows, ist von der gleichzeitigen Demokratisierung und Ent-Demokratisierung der Demokratie gekennzeichnet: Es ist die drastische Ausweitung von Partizipationschancen, die im Zentrum der Krise politischer Repräsentation steht. Diese Krise aber transformiert den Streit in der Demokratie zu einem Streit über die Demokratie - der ist jedoch demokratisch nicht zu führen.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.

Hassreden und Celebritys: Philip Manow verteidigt die Demokratie gegen die Risiken ihres Erfolgs
Ein halbes Jahrhundert nach Willy Brandts Regierungserklärung, "mehr Demokratie wagen" zu wollen, verbreitet sich der Eindruck einer Krise der Demokratie aus gegensätzlichen Richtungen: Die einen fordern eine Rückbesinnung auf demokratische Volkssouveränität, während die anderen ebendiese Forderung für populistisch und demokratiegefährdend halten. Diese unübersichtliche Situation erklärt der Bremer Politikwissenschaftler Philip Manow damit, dass eine immer weiter reichende Demokratisierung der Demokratie mit ihrer gleichzeitigen Entdemokratisierung einhergehe. Wir hätten es nicht mit einer Krise der Demokratie als solcher zu tun, sondern mit einer so massiven Ausweitung politischer Partizipationschancen, dass durch sie eine Krise der Repräsentation bewirkt werde, weil diese inklusiv geworden ist und keine Selektion mehr vornimmt.
Manow diagnostiziert daher keine "Postdemokratie" im Sinne Colin Crouchs; vielmehr sei die Kandidatenauswahl der Parteien durch Mitgliederentscheide so radikal demokratisiert worden, dass die Konflikte zwischen den Parteien abgenommen hätten. Zugleich habe das journalistische Interesse an Personenkonkurrenzen die innerparteilichen Konflikte verschärft. Deshalb haben sich Manow zufolge in den westlichen Demokratien billige, aber leicht multiplizierbare Formen politischer Auseinandersetzung durchgesetzt. Für all dies steht beispielhaft Donald Trump, der sich mit einem vergleichsweise bescheidenen Wahlkampfbudget innerparteilich durchsetzen konnte, weil ihm seine fehlende Rücksichtnahme eine beispiellose Polarisierung ermöglicht habe.
Sowenig Manow eine Krise der Demokratie als solcher ausmachen kann, so deutlich benennt er, dass diese fehlende Krise eine andere Krise bewirkt: die Radikalisierung durch fortschreitende Demokratisierung. An die Stelle politischer Rationalität treten Hassreden und die "Celebritysierung" des Führungspersonals, mit dem paradoxen Ergebnis einer Entdemokratisierung der Demokratie infolge ihrer immer weitergehenden Durchsetzung. Denn während Abgrenzungen früher auf das Außenverhältnis zu nichtdemokratischen Staaten konzentriert waren, sei es mit der fortschreitenden Durchsetzung der Demokratie zu einem "Wiedereintritt der Unterscheidung demokratisch/undemokratisch in die demokratische Auseinandersetzung selbst" gekommen, in der nun politische Gegner zu antidemokratischen Feinden würden und der politische Streit innerhalb der Demokratie zu einem zerstörerischen Streit über die Demokratie.
In dieser demokratischen "Autoimmunreaktion", dem Gegner keine guten Absichten mehr zuzugestehen, sondern ihn als um jeden Preis zu verhindernden Demokratiefeind anzusehen, sieht Manow ein gespenstisches Fortleben der "abgestorbenen Konkurrenzutopien des zwanzigsten Jahrhunderts, Faschismus und Kommunismus" im Sinne des wechselseitigen Verdachts, der politische Konkurrent wolle die Demokratie "entweder völkisch deformieren oder internationalistisch auflösen".
Diese Analyse ist durchdacht und eingehend belegt, und sie leistet eine ebenso umfassende wie überzeugende Deutung der politischen Gegenwart. Gleichwohl überdehnt Manow seinen Ansatz an wichtigen Stellen. So wirbt er um Verständnis für den Populismus als "Überbringer der schlechten Nachricht" von der Krise der Demokratie, weil der Wunsch nach Wiedererlangung politischer Souveränität zwar demagogisch und verlogen erscheinen möge, aber demokratisch mobilisieren könne und daher verstanden werden müsse, zumal es ja zur Wahl der Populisten komme, ohne dass man darin den "Auftrag zur Abschaffung der Demokratie" erkennen könne. Dieses Entgegenkommen ist umso unbegreiflicher, als Manow eindrucksvoll auflistet, wie nicht nur in Mittel- und Osteuropa, sondern auch in westlichen Staaten demokratische Prinzipien bekämpft werden, wenn beispielsweise der britische Premierminister Johnson versucht, das Parlament auszuschalten, oder der amerikanische Präsident sich vorbehält, Wahlergebnisse nicht anzuerkennen. Man wird also zwischen Populismus und Extremismus unterscheiden müssen, und Irrationalität ermöglicht kein Verständnis, wie im Fall der osteuropäischen Ängste vor Migration, die nur eine Projektion des Entsetzens über den unvergleichlich größeren Exodus der eigenen Bevölkerung sind.
Nicht nachvollziehbar ist auch Manows Behauptung eines Gegensatzes zwischen Demokratie und Universalismus, denn Letzterer ist die Grundlage der Menschenrechte und hat nichts mit der Dystopie eines tyrannischen "Weltstaates" zu tun. Zudem bedient Manow das falsche Stereotyp eines Gegensatzes zwischen demokratischer Volkssouveränität und liberaler "Juristokratie", die eine "fortschreitende Entpolitisierung" bewirke. Auch das ist umso unverständlicher, als Manow nicht nur die Einsicht Adam Przeworskis zitiert, dass Konflikte eskalieren, wenn sie aus Institutionen auswandern, sondern auch den Satz Jacques Derridas, die Politisierung von Gegensätzen mache diese immer antagonistischer. So bleibt es bei der Feststellung von Bundespräsident Steinmeier: "Demokratie ist liberal - oder sie ist nicht." Aber diese Irrwege schmälern nicht den Wert von Manows Buch, das wichtige Impulse bietet.
KARSTEN FISCHER
Philip Manow:
"(Ent-)Demokratisierung der Demokratie". Ein Essay.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2020. 215 S., br., 16,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Der Politologe Philip Manow hat ein tiefschürfendes demokratietheoretisches Gedankenfeuer über die Gefährdung der Demokratie vorgelegt.« Tom Wohlfahrth taz. die tageszeitung 20200628