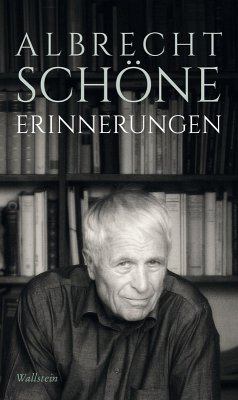Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Emblematik der Treue: Der Germanist Albrecht Schöne hat seine Erinnerungen geschrieben
Dem Germanisten Albrecht Schöne, der kürzlich seinen fünfundneunzigsten Geburtstag feierte, wurde Goethe, dem er mehrere Bücher gewidmet hat, zuletzt eines über den "Briefschreiber", nicht in die Wiege gelegt. Sondern neben die Wiege beziehungsweise genaugenommen neben den Kinderwagen gestellt. In den "Erinnerungen", die Schöne zunächst für seine Enkel niederschrieb und dann doch seinem Schüler Thedel von Wallmoden für den von diesem gegründeten Wallstein Verlag übergab, druckt er einen Brief ab, den sein Vater ihm schrieb, als er zehn Tage alt war. Der Adressat fand ihn nach dem Tod des Vaters unter dessen Papieren.
Friedrich Schöne war Studienrat im Städtchen Barby an der Elbe und beschreibt seinem schlafenden Stammhalter dessen Umgebung: das väterliche Arbeitszimmer mit Schreibpult, Bücherregalen und Bildern an der Wand. Mit Fragen, die der Angesprochene noch nicht verstehen kann, greift er der Zeit vor. "Du kleiner Kerl, der Du jetzt aus sattem Kinderschlaf aufseufzest, wann wirst Du zum ersten Mal mit funkelnden Augen und heißen Wangen in die Schätze greifen, die da neben Deinem Wagen stehen? Den ersten Band Goethe und Shakespeare, Tolstoi und Hebbel aufschlagen?"
Albrecht Schöne behandelt seinen Vater nicht wie den "Briefschreiber Goethe", von dem er neun Briefe (darunter keinen an den Sohn August) auswählte, um sie Stück für Stück mit einem Vielfachen an Textmenge zu erläutern. Dabei eignete sich zweifellos auch Friedrich Schönes unveröffentlichtes, dem Empfänger nicht einmal ausgehändigtes Briefzeugnis als Stoff für die Germanistik, wie Albrecht Schöne ihn bestimmte, als er 1985 in Göttingen die Teilnehmer des ersten Weltkongresses seiner Disziplin auf deutschem Boden willkommen hieß: Es geht seinem Fach um "Schriftwerke", anhand derer sich eine "Fülle an historischer Erfahrung und Einsicht in die Möglichkeiten des Menschen" vermitteln lässt, "an Orientierungsmustern und Handlungsanleitungen, Trostgeschenken, Fluchthilfen, Lebens- und Sterbemitteln".
An den Topoi, die Studienrat Schöne bei der feierlichen Begrüßung seines Erstgeborenen verwendete, müsste sich bestätigen, was Professor Schöne im Resümee seiner komparatistischen Untersuchung der Figur "Auf Biegen und Brechen" notiert, mit dem er auch seine Studien zur Emblematik, ja, seine gesamte Arbeit zusammenfasst: "Allemal erweist sich das literarische Motiv so als Indikator der religiösen, wirtschaftlichen, politischen und sozialen Verhältnisse, die seinen unterschiedlichen Spielarten zugrunde liegen."
Die Verhältnisse der eigenen Familie bestimmte jene soziale Formation, deren grundlegende, Formen prägende Bedeutung für die deutsche Literatur Albrecht Schöne in seiner Habilitationsschrift über die "Säkularisation als sprachbildende Kraft" in der "Dichtung deutscher Pfarrersöhne" darstellte. Er ist Enkel, Urenkel und Neffe von Pfarrern, und zwar der altlutherischen Freikirche, die sich der vom preußischen König befohlenen Zwangsunion mit den Reformierten verweigerte. Inwieweit auch Albrecht Schönes Schriftwerke die sprachbildende Kraft des vom Pfarrhaus freigesetzten Strebens nach Selbständigkeit illustrieren, werden spätere Literaturhistoriker erörtern. Der Autor der Memoiren nimmt keine sozialgeschichtliche Auslegung der Urkunden seiner Herkunftswelt vor. Knapp bleibt der Kommentar zum Brief des Vaters, weil dieser mit didaktischem Sinn abgefasst ist, in einer Deutlichkeit, die trotz allem Abstand der Zeit geeignet ist, Missverständnissen vorzubeugen.
Drei Bilder hingen über dem Kinderwagen, rechts außen ein Kupferstich nach van Dyck: "der König Karl I von England, hochmütig-müde und abenteuerlich-haltlos zugleich, gepflegt und brutal - so sollst Du nicht werden". Was lernen wir? Zum Mobiliar im bürgerlichen Bildungshaushalt gehören Figuren, zu denen man aufblickt, um sich an ihnen gerade kein Beispiel zu nehmen. Der hingerichtete König in der von van Dyck verewigten Gestalt erschien nicht etwa, was man sich unter Altlutheranern auch hätte vorstellen können, als Märtyrer des Gewissens und Patron eines romantischen Konservatismus denkwürdig. Vielleicht hatte Friedrich Schöne die "Geschichte der englischen Revolution" von Friedrich Christoph Dahlmann gelesen, wo man sowohl die abenteuerlichen als auch die brutalen Züge findet: Karl gefiel sich "auf gefährlichen Wegen" und war lange vor dem Abfall des Parlaments "von allen guten Geistern verlassen".
Dahlmann gehörte 1837 zu den Göttinger Professoren, die wegen ihres Protests gegen die Aufhebung der Verfassung des Königreichs Hannover ihrer Ämter enthoben und des Landes verwiesen wurden. Albrecht Schöne hielt 1987 über diese Göttinger Sieben einen mehrfach gedruckten Vortrag; im vergangenen Jahr bestimmte die Universität, dass dieses "Lehrstück" allen nach Göttingen berufenen Professoren und allen Absolventen des Doktorexamens auszuhändigen ist.
Vielleicht hatte Schöne Dahlmann, Jacob Grimm und Kollegen auch im Sinn, als er am 5. Oktober 1990 in Peking am Ende eines Vortrags zum Streit der Aufklärer über die Physiognomik das Bild eines Verhafteten vom Platz des Himmlischen Friedens aus dem Staatsfernsehen zeigte. Der Tag war ein Freitag, und Kollegen hatten ihm vorausgesagt, dass die Behörden erst am Montag aktiv werden würden, nach seiner Abreise. "So habe ich nicht kennenlernen können, was ich erwartet, mir eigentlich auch gewünscht hatte: Wie man in Peking das politische Verhör eines Ausländers vornahm, wie sich dort eine Nacht in polizeilichem Gewahrsam abspielte und wie zu guter Letzt eine Zwangsabschiebung vor sich ging." Zu guter Letzt! Dieser Auskunft zufolge war Schöne eine Neigung zum Abenteuerlichen nicht fremd, und so wird man es nicht einfach nur ironisch lesen, wenn er zu dem vom Vater geerbten Porträt des Stuart-Königs mitteilt, es rufe ihm "bei Gelegenheit noch immer in Erinnerung, wie ich nicht werden sollte". Es gibt eine Treue der fortgesetzten Abweichung.
Im Rechenschaftsbericht über seine Berufsarbeit lässt sich Schöne mit größter Bestimmtheit ein. Es sticht ins Auge, dass er Widersacher stets beim Namen nennt, nicht nur in dem in dieser Zeitung (F.A.Z. vom 15. November 2017) vorabgedruckten Lehrstück über 1968. Umschreibungen, die nur die Neugier reizen müssten, wären unter seiner Würde; fingierte Nachsicht ist keine. Man kann sich ausmalen, dass dieser selbstbewusste Herr der eigenen Worte auch als schroff erlebt werden konnte; vielleicht sah er sich deshalb von Zeit zu Zeit veranlasst, an das mahnende Exempel Karls I. zu denken.
Albrecht Schöne hat mit diesem Erinnerungsbuch zu Händen seiner Enkel einen Text von ähnlicher Bestimmung verfasst, wie ihn sein Geburtstagsbrief von der Hand seines Vaters hatte. Was möchte er den Adressaten sagen? Darüber müssen wir als Außenstehende nicht spekulieren, aber weil das Buch nicht als Privatdruck verbreitet wird, sei wenigstens eine Vermutung geäußert, im Namen derer, die als Leser Schönes so kühn sind, sich zu seinen Enkelschülern im Geiste zu gesellen. Der Herkunftszusammenhang einer geistigen Welt tritt uns in einer sprachlichen Gestalt vor Augen, für die das Klare und Deutliche konstitutiv sind. Markiert wird durch den Stil freilich auch, wie viel nicht artikuliert wird. Bürgerliche Bildung erweist sich als Mischungsverhältnis von direkter und indirekter Rede, Gesagtem und Ungesagtem.
Und das gilt auch für die außerliterarische Lebensthematik eines Deutschen vom Jahrgang 1925. Die erste Hälfte des durchgehend lehrreichen und stellenweise erschütternden Buches behandelt die Schicksale von Schönes Familie in der Hitlerzeit, die zweite seine akademische Laufbahn. Der Vater wurde strafversetzt, weil er die Hakenkreuzfahne nicht hisste, ein Onkel wäre beinahe vor den Volksgerichtshof gestellt worden, weil er nach der Schlacht von Stalingrad die Wahrheit ans Licht zu bringen versuchte, mit dem Mittel des Kettenbriefs. Albrecht Schöne erlebte das Kriegsende als Leutnant der Panzertruppe.
Die Mitte des Buches ist das Kapitel "Unter Holzfällern". Bei der Schwerstarbeit, die Schöne im Winter 1946/47, vor der Zulassung zum Studium, im Sauerland verrichtete, wurde fast gar nicht gesprochen. Unter den Männern waren Überlebende der Lager, Vertriebene, aber auch gestürzte Funktionäre des Regimes. Was der Abiturient über die jüngste Vergangenheit gehört oder gelesen hatte, "das stellten meine Arbeitsgenossen mir jetzt leibhaftig vor Augen". Fernab von der Familienwelt mit "Pfarrhaus" und "Schulbetrieb" kam "das Vergangene" über ihn "mit großer Gewalt". Ein Wort der Bibel wurde ihm "in gewisser Weise lebensbestimmend", in einer von der Erfahrung des Schweigens aufgedrängten Auslegung: der dreißigste Vers des siebten Kapitels des ersten Korintherbriefs, als Grundsatz einer Philosophie des Als-ob, des Lebens aus dem Konjunktiv. "Es fällt mir schwer, mich dabei verständlich zu machen." So viel glauben wir doch zu verstehen: Als befreiend erlebte Albrecht Schöne eine fortwirkende Hemmung. Das Emblem seines Lebens müsste ein Paradox zeigen: die durch Bindung gelöste Zunge.
PATRICK BAHNERS
Albrecht Schöne: "Erinnerungen".
Wallstein Verlag, Göttingen 2020. 334 S., geb., 28,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main