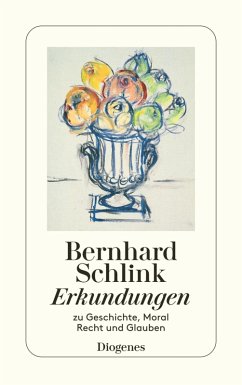Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Auf der Kanzel: Morgen erscheinen Bernhard Schlinks Überlegungen zu Geschichte, Recht und Glauben
Bernhard Schlink, emeritierter Lehrstuhlinhaber für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universität, langjähriger Richter am Verfassungsgerichtshof Nordrhein-Westfalens und erfolgreicher Romancier, legt eine Sammlung von Reden, Essays und Predigten aus den letzten zehn Jahren vor. Es geht um die Spannungen von Recht und Moral, die Konflikte des Juristen zwischen positivem Recht und Gerechtigkeit, das Opfer des Lebens für die Solidargemeinschaft der demokratischen Nation und schließlich den skeptischen Zweifel am Christusglauben der Väter, der bei Schlink die Gestalt frommer, meditativer Selbstreflexion gewinnt.
Mehrfach kommt Schlink auf seine Erfahrungen mit Studierenden zu sprechen. Stärker als in früheren Texten besinnt er sich auf seine Herkunft aus der Heidelberger bildungsprotestantischen Gelehrtenwelt der Nachkriegszeit. Schlink ist der Sohn des einst einflussreichen konservativ-lutherischen Ordinarius für Systematische Theologie Edmund Schlink, der mit großer intellektueller Ernsthaftigkeit an der alten These festhielt, dass theologische Denkarbeit primär als Dogmatik, bezogen auf eine objektiv vorgegebene Kirchenlehre, zu vollziehen sei. Diese Begeisterung für klare Dogmatik und begrifflich konsistentes System scheint der Vater dem Sohn erfolgreich vermittelt zu haben.
In einem Essay über den Wandel der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts klagt Bernhard Schlink darüber, dass sich Karlsruhe zunehmend von der Tradition dogmatischer Rechtswissenschaft und Rechtsprechung verabschiedet habe und zu kasuistischer Rechtsprechung übergegangen sei. Damit verbinde sich ein "Abschied von der Selbstbindung durch Dogmatik". So gewönnen die Entscheidungen des Gerichts immer stärker "ein Moment der Beliebigkeit".
Ältere Professoren neigen dazu, die akademische Jugend kritisch zu sehen. Aus Seminaren zur Geschichte der Rechtswissenschaft berichtet Schlink Irritierendes: Die durchaus historisch interessierten Studierenden hätten durchweg sehr kritisch über die behandelten Juristen des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts gesprochen und waches Gespür für die ideologische Korrumpierbarkeit gerade des öffentlichen Rechts bewiesen. Aber sie hätten auch mit einem selbstbewussten Moralismus die Klassiker des Faches auf ihre politisierte Anklagebank gesetzt. "War der Autor als reaktionär oder als interessen- und wirklichkeitsblind oder als nicht hinreichend demokratisch oder als nationalsozialistisch oder kommunistisch identifiziert, dann war er erledigt."
Schlink spricht von einer "Kultur des Denunziatorischen", in der moralische Maßstäbe von heute, etwa die Menschenrechte, ganz unvermittelt an Denkwelten der Vergangenheit angelegt würden. Für eine Bewertung geschichtlicher Akteure im Horizont ihrer je eigenen Zeit hätten seine Studierenden so gut wie keinen Sinn entwickelt. Schlink insistiert hier auf dem historistischen Credo, dass jede moralisch faire Beurteilung geschichtliche Akteure nur mit jenen Maßstäben messen dürfe, die sie für sich selbst gelten lassen wollten. Damit predigt er keinen Relativismus, aber einen differenzierungssensiblen Kontextualismus, der das elementare Anderssein vergangener Zeiten ernst zu nehmen versucht. Es immer wieder sehr viel besser zu wissen als die Menschen von früher sei obendrein nur langweilig. Es erfordert jedenfalls wenig intellektuellen Aufwand.
Wer Verfassungsrecht lehrt, muss ein politisch aufmerksamer Beobachter des Gesetzgebers sein. Immer wieder hat Schlink sich in aktuelle rechtspolitische Debatten eingeschaltet. Im Essay über das "Opfer des Lebens" entwirft er einen deutschen Sonderweg im Opferdiskurs: "In Deutschland ist die Rolle des Opfers, das man bringt, besonders diskreditiert und wird die Rolle des Opfers, das man ist, besonders gewürdigt." Der überkommenen Heroisierung der Opferbereitschaft sei eine Sprachlosigkeit gefolgt, die es nicht mehr erlaube, jene Opfer für das Gemeinwesen angemessen zu rechtfertigen, auf die der demokratische Rechtsstaat in Zeiten terroristischer Bedrohung angewiesen sein könnte. Soldaten, Polizisten, Feuerwehrleute und auch andere Bürger hätten ein Anrecht auf angemessene öffentliche Rechtfertigung des Opfers, das man von ihnen im schlimmsten Falle fordere.
So untersucht er klassische Legitimationstheorien auf ihre aktuelle Brauchbarkeit hin und entwickelt mit einem demokratietheoretisch gelesenen Kant die These, dass eine Gemeinschaft, die von ihren Mitgliedern Opferbereitschaft verlangt, deren Menschenwürde nicht verletzt, wenn "die Glieder der Gemeinschaft" dem gegebenenfalls zu erbringenden Opfer zugestimmt haben oder zugestimmt hätten. Allerdings sieht Schlink auch, dass man eine funktional differenzierte und pluralistische "Gesamtgesellschaft" kaum noch als "Solidargemeinschaft" denken kann. Dennoch weitet er den Begriff des "solidarischen Opfers" auf ungeborenes Leben aus und schlägt vor, die bei einer künstlichen Befruchtung entstandenen und nicht eingesetzten Embryonen "für die Forschung zu opfern", habe dieses Leben doch ohnehin nicht die Chance zu individueller Entfaltung als Mensch und Person. Ob für dieses Opfer eine Rechtfertigung aus der zumindest potentiellen "Zustimmung in der Gemeinschaft" tragfähig ist, kann man auch als Kantianer bezweifeln.
Zu den überraschendsten Entwicklungen in den Ethik-Diskursen der Moderne gehört die steile Karriere des Verantwortungsbegriffs. Schlink diagnostiziert eine tiefe Krise der Verantwortung in der Gegenwart, die "Verantwortungsüberforderung". In einer kritischen Analyse der Theorien funktionaler Differenzierung fragt er, wer denn die Verantwortung fürs Ganze hat, wenn die Folgeprobleme des Handelns in einem partikularen Subsystem auch die anderen Subsysteme der Gesellschaft und "das System" insgesamt beträfen. Bei den Funktionseliten in den einzelnen Subsystemen sieht er zwar viel Professionalität in der Wahrnehmung systemspezifischer "Kernverantwortungen". Aber die Systemtheorie kenne keinerlei Instanz, die Verantwortung für das übernehmen könne, "was die Gesellschaft zusammenhält".
Der Staat könne diese "Instanz für den Zusammenhalt" nicht sein. Religiöse Appelle an den Einzelnen genügten auch nicht. Für jene Verantwortung, die den Horizont der Systemtheorie überschreitet und die "Wirkungen des systemimmanenten Handelns auf andere Systeme und die Gesellschaft als ganze berücksichtigt", setzt Schlink auf die Institutionalisierung von "Festlegungen und Einrichtungen", die, wie Ethikräte gezeigt hätten, Maßstäbe setzen und Verbindlichkeit schaffen könnten. So soll gebotene "Außenverantwortung" in das Innere der Funktionssysteme eingeholt werden.
In einem Loblied auf die professionsspezifischen Kompetenzen von Juristen kann Schlink angehenden Referendaren aber auch sagen: "Juristen sind Problemlöser, bringen Soziales zum Funktionieren und halten es am Funktionieren und, um das Funktionieren zu gewährleisten, funktionieren sie selbst. Für uns Juristen ist das Funktionieren unser Daseinszweck und unsere Daseinsweise." Haben Juristen keine darüber hinausweisende professionsspezifische Verantwortung? Schlink klagt sie als Bereitschaft ein, in den Institutionen des positiven Rechts dafür zu sorgen, dass diese "der Entfaltung der Gerechtigkeit Raum geben".
In drei klugen Kanzelreden legt Schlink zentrale Texte der neutestamentlichen Überlieferung aus. Die in Lukas 16 tradierte Parabel vom reichen Lazarus liest er gegen jahrhundertelange Exegese nicht als eine Geschichte ausgleichender göttlicher Gerechtigkeit, sondern als Gleichnis vom wahren Reichtum des Lebens. Wirklich reich sei, wer alle materiellen Güter hinter sich lassen und sich den Menschen öffnen könne, die ihm auf den Wegen endlichen Lebens begegneten. Das "Eigentliche des Lebens" sei etwas ganz anderes "als unser Machen und Haben, unser Erfolg und unser Ruhm". Der Prediger Schlink preist die Freiheit, die daraus erwachse, "dass wir uns auf die Umstände, in den wir leben, nicht festlegen lassen" und "immer wieder aufbrechen, immer wieder anfangen können".
Ganz wie einst Adolf von Harnack predigt er: "Das Eigentliches des Lebens ist unsere Seele und deren ewiges Leben." Irgendein postmortales Jenseits mit einem göttlichen Weltgericht am Ende der Zeiten verkündet Schlink damit nicht. Den ihm sehr lieben Satz aus Matthäus 25, "Was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan", deutet er als verdichteten Ausdruck der Lebenswahrheit, "dass nichts Gutes, das wir tun, verlorengeht". Wir sollen "gut miteinander umgehen", "uns aneinander und miteinander freuen". Dann können wir uns auch mit unserer Vergänglichkeit versöhnen und gelassen den Tod annehmen, auch "ohne Jenseitshoffnung". Um 1900 nannte man dies im liberalreligiösen Berlin "Diesseitschristentum".
FRIEDRICH WILHELM GRAF
Bernhard Schlink: "Erkundungen zu Geschichte, Moral, Recht und Glauben".
Diogenes Verlag, Zürich 2015. 288 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH