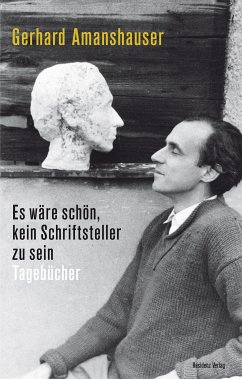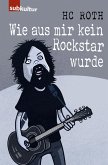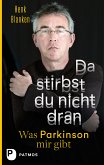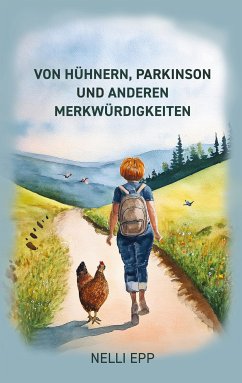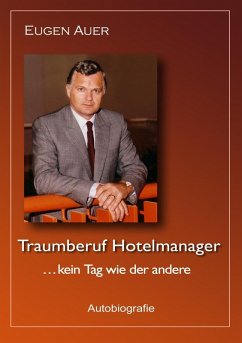Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Offene Form, unangestrengte Welterfassung, radikale Skepsis: Gerhard Amanshauser in seinen Tagebüchern
"Was ich alles war: Halb-Nazi, Halb-Sportler, Halb-Liebhaber, Halb-Mathematiker. Groß war ich nur im Nichtstun, im In-die-Luft-Schauen. Aber ich erkannte den Zustand der Gesellschaft, war nicht profan." So zieht der Salzburger Gerhard Amanshauser, Jahrgang 1928, die Bilanz seines Lebens, ungeschönt und mit einem radikalen Bekenntnis zur Halbheit. Dass seine NS-Karriere beim Hitlerjungen steckenblieb, dass er nicht mehr an die Front kam, verbucht er als mangelnde Gelegenheit zur moralischen Verfehlung. Sein Studium schloss er nicht ab, doch blieb er sein Lebtag der Mathematik und den Naturwissenschaften verbunden.
Uneitle Künstler sind an sich eine seltene Erscheinung. Bei Gerhard Amanshauser, einer wesentlichen und allzu dezenten Stimme der österreichischen Nachkriegsliteratur, hat das Fehlen von Eitelkeit aber ein geradezu pathologisches Ausmaß. Dies betrifft insbesondere seine Profession, die als solche zu betrachten ihm ohnehin problematisch war: "Muß man nicht beträchtlich dumm sein, wenn man als Schriftsteller herumreist und auch noch an sich glaubt? Sich auch noch wichtig vorkommt? Bedeutungsspeck ansetzt?"
Die vom Sohn des Autors, Martin Amanshauser, klug ausgewählten Tagebuch-Passagen aus 35 Jahren zeigen eine intellektuelle und künstlerische Entwicklung, in der es keine Desillusionierung gibt: Von Anfang an sieht der Vater alles Gesellschaftliche und damit auch seinen Platz im als lachhaft erkannten Literaturbetrieb rabenschwarz. Auch als ganz Junger kommt Gerhard Amanshauser ohne Enthusiasmus aus. Das deprimiert und imponiert. Geradezu körperlich leidet der Tagebuchschreiber unter der Herrschaft des Pöbels und der touristischen Welteroberung. "Aus dem Leben der Quaden" hieß sein Erstling 1968, eine Satire. Die Quaden, das sind in der Sprache des Apokalyptikers die Barbaren, die bedenkenlosen Konsumenten.
Gerhard Amanshauser hasst die als Fortschritt getarnte Industrialisierung und verachtet die Avantgarde und ist dennoch kein Konservativer im politischen Sinn. Seine Abneigung gegen alles Katholische, aber auch gegen Gläubige überhaupt, an deren Verstand er zweifelt, tritt als eine Art Allergie auf. Sein Weltzugang ist der des diagnostischen Essays und der Satire, wie in dem Roman "Schloß mit späten Gästen", der ihn 1975 bekannt machte. In seinen Büchern - etwa dem "Terrassenbuch" (1973) oder dem "Mansardenbuch" (1999) - huldigte er der offenen Form und der unangestrengten Welterfassung. Er sah seinen Freundeskreis als Zirkel von größenwahnsinnigen Gescheiterten und sich selbst ebenfalls als gescheitert, wenn auch ohne Größenwahn.
"Wenn die Üppigkeit des Sommers vergangen ist: Transparenz eines heiteren Septembertags, das Grün gleichsam verdünnt, mit ersten gelblichen Spuren durchsetzt, hinüberzögernd in den Herbst. So müsste mein Stil sein." Über die Werke der meisten seiner berühmten wie unberühmten Zeitgenossen urteilt er mit derselben Unerbittlichkeit wie über die eigenen. Seinen Mentor Hermann Hakel, einen jüdischen Schriftsteller von imposanter Intelligenz, der auch Ingeborg Bachmann, Marlen Haushofer und Walter Buchebner förderte, schildert Amanshauser bei aller Liebe als ermüdenden Dauerredner und miserablen Lyriker. Sein Freund H. C. Artmann ist ihm als Gaukler verdächtig, später bewundert er ihn doch als den letzten romantischen Dichter. Gerhard Rühm hält er für einen eitlen Artisten ohne Substanz, André Heller nennt er "Schnulzensänger", Rolf Hochhuth einen "durch und durch deutschen Nichtskönner widerlicher Art", Peter Handke findet er "sensibel, intelligent, doch ohne Würze", Helmut Qualtinger "trotz traurigem Zustand" genial. Gelten lässt er auch, als Dichter wie Gesprächspartner, Elias Canetti und Ilse Aichinger. Die literarische Welt sieht Amanshauser als eine der Prostitution, sich selbst, der die "verfluchte Leserei" vor einer Handvoll Zuhörer des Geldes wegen auf sich nimmt, als Hure.
Ein Kostverächter ist Amanshauser indes nicht, sein Weltekel erstreckt sich nicht auf körperliche Freuden. Er liebt das Meer, Italien, lernt Chinesisch. Als Gärtner und Astronom beobachtet er mit Hingabe die Natur, das Wetter, die Sterne. Die Konjunktion von Venus und Jupiter 1975 kommentiert Amanshauser mit dem Hinweis, die nächste, 1999, werde er kaum erleben. Doch er erlebt, schon schwer an Parkinson erkrankt, auch noch den Venus-Durchgang 2004 und stirbt zwei Jahre später in Salzburg.
Und die Literaturgeschichte? "Es könnte ja wahr sein, was ich sage. Ich könnte der sein, für den ich mich halte. Weiß man denn, was einer ist? Was wir sind, hängt ab von einem Maßstab, den man in der Zukunft erfinden muss." Amanshausers eigensinniges Werk sollte diesem Maßstab standhalten.
DANIELA STRIGL
Gerhard Amanshauser: "Es wäre schön, kein Schriftsteller zu sein".
Tagebücher.
Vorwort von Daniel Kehlmann. Residenzverlag, St. Pölten/ Salzburg/Wien 2012. 397 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH