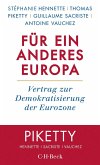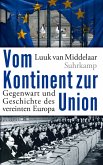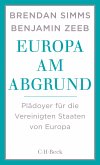Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Claus Offe empfiehlt eine Generalüberholung der EU
Der europäische Einigungsprozess ist durch die Kumulation und Verschleppung zahlreicher Krisen - von der Verfassungs- über die Währungs- bis zur Flüchtlingsfrage - in eine selbstgestellte Falle geraten. Das bestreitet heute kaum noch jemand. Gestritten wird darüber, wie es dazu kommen konnte und auf welche Weise sich die Europäer aus ihrer Zwangslage wieder befreien können. Der emeritierte Berliner Politikwissenschaftler und Soziologe Claus Offe gibt einer von "neoliberalen Ideologen" und "fanatischen Marktideologen" falsch konstruierten Wirtschafts- und Währungsunion die Schuld. Angesichts dessen plädiert er für eine "institutionelle Generalüberholung der EU", bei der Lasten und Zuständigkeiten neu verteilt werden müssten.
Eine Neuausrichtung des Integrationsprozesses scheitert seiner Ansicht nach bislang daran, dass die politischen Eliten in den Mitgliedstaaten die notwendigen Veränderungen ihren Bürgern nicht vermitteln können, weil die Parteien weiterhin "wesentlich nationale Machterwerbsorganisationen" bleiben. Als Ausweg aus der Sackgasse schlägt Offe ein Bündel politischer und ökonomischer Reformen vor, die darauf hinauslaufen, innerhalb der Eurozone eine "supranationale Demokratie" mit einer vollwertigen gewählten Legislative und kontrollierbaren Regierungsbehörden zu schaffen.
Im Rahmen dieser übernationalen Demokratie will er einen Schuldenschnitt für die südeuropäischen Staaten organisiert wissen. Zusätzlich sollen die direkten Steuern innerhalb der EU vereinheitlicht sowie eine stärkere Belastung höherer Einkommen und Vermögen, möglicherweise auch in Form von Zwangsanleihen, durchgesetzt werden. Eine Vergemeinschaftung der Arbeitslosenversicherung und der Sozialhilfe sowie europäische Arbeitsbeschaffungsprogramme für Jugendliche ohne Jobs runden die Vorschlagsliste ab. Durch derartige Nachweise fiskalpolitischer Aktivität und sozialpolitischer Fürsorglichkeit, so Offe, würde die EU ihre Glaubwürdigkeit erhöhen und sich "robuste Legitimität als supranationaler Akteur verschaffen". Sie erreiche auf diesem Wege außerdem jene makroökonomische Stabilisierung, an der es ihr bisher mangele.
Abgesehen von der Frage, wie diese Rezeptur den Wählern in Deutschland, Österreich, den Niederlanden oder Finnland zu vermitteln ist, die sie zu finanzieren hätten, provozieren Offes Diagnose und Therapie eine Reihe kritischer Einwände. Erstens wird die Legende von der Währungsunion als neoliberaler Verschwörung finsterer Kapitalisten und gieriger Banker durch Wiederholung nicht richtiger. Der Euro war von seiner Entstehungsgeschichte und Zielsetzung her von Anfang an ein politisches Projekt, das mit historischen Notwendigkeiten begründet wurde. Wirtschaftliche Überlegungen waren zweitrangig, zumal gerade "neoliberale Ideologen" und "fanatische Marktradikale" unter den deutschen Ökonomen eindringlich vor der Einheitswährung warnten.
Zweitens kommen bei Offe gravierende Unterschiede zwischen den verschiedenen europäischen Ländern und Volkswirtschaften nicht einmal ansatzweise zur Sprache. Damit sitzt er dem gleichen Trugschluss auf wie die Konstrukteure der Währungsunion, die glaubten, man könne zunächst elf, heute 19 Nationalstaaten in einem System unveränderlicher Wechselkurse zusammenfassen und die negativen Folgewirkungen durch mehr oder weniger kluge institutionelle Arrangements und Verhaltensregeln im Griff behalten. Dieser Hoffnung stand von Anfang an die Tatsache entgegen, dass die Mitgliedstaaten der Währungsunion sich in ihren kulturellen und politischen Traditionen, in den vorherrschenden Mentalitäten und Denkweisen zum Teil gewaltig voneinander unterschieden und bis heute unterscheiden: Ihre Wirtschaftskraft ist ungleich entwickelt. Sie besitzen verschiedenartige Verwaltungs-, Steuer- und Sozialsysteme und weichen auch im Hinblick auf die in ihnen gegebenen Arbeitsmarktbedingungen stark voneinander ab. Die Gesellschaften in der Eurozone stimmen weder in ihrem Konsumverhalten noch in den vorherrschenden Einstellungen zur Inflation oder zur Arbeits-, Zahlungs- und Steuermoral überein. Nur eine allmähliche Angleichung der verschiedenen europäischen Wirtschaftskulturen könnte Abhilfe schaffen. Diese ist allerdings nur in langen Fristen möglich und benötigt deutlich mehr Zeit, als der Druck der ökonomischen Entwicklung der Politik lässt.
Drittens ist nicht erkennbar, wie durch die massiven Transfers, die Offe vorschweben, die Lage im Süden Europas dauerhaft verbessert werden kann. Viel spricht dafür, dass in der gegenwärtigen Diskussion makroökonomische Themen der europäischen (oder besser: eurozonalen) Ebene über Gebühr viel Aufmerksamkeit finden, während die für eine Erholung der Arbeitsmärkte und der Wettbewerbsfähigkeit der südeuropäischen Staaten (und Frankreichs) wichtigeren Fragen mikroökonomischer Strukturreformen auf nationaler Ebene in den Hintergrund treten.
Die Remedur, die Offe der EU verschreibt, würde zu weiterer Bürokratisierung und Zentralisierung führen. Sie würde Verteilungskonflikte innerhalb Europas perpetuieren und die Stellung der europäischen Volkswirtschaften im globalen Wettbewerb schwächen. Das wäre der sicherste Weg, um das noble Projekt der europäischen Einigung endgültig zu ruinieren.
DOMINIK GEPPERT
Claus Offe: Europa in der Falle. Suhrkamp Verlag, Berlin 2016. 188 S., 16,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main