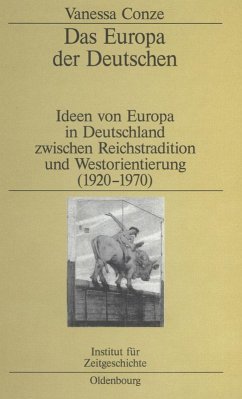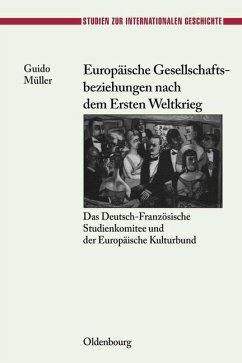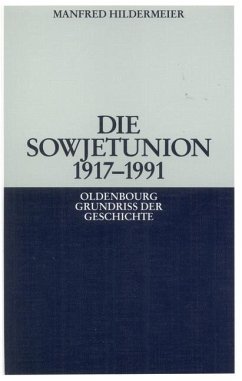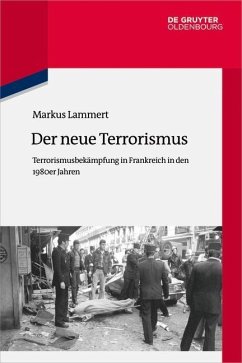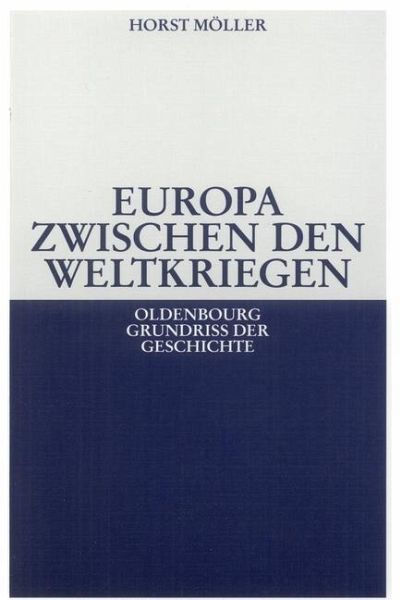
Europa zwischen den Weltkriegen (eBook, PDF)

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die instabile internationale Ordnung und die extreme innere Labilität der meisten europäischen Staaten kennzeichnen die Jahre zwischen den Weltkriegen. Horst Möller gelingt eine Darstellung dieser politisch vielfältigen und bewegten Zeit, indem er sich auf die wesentliche Frage konzentriert: Warum waren die beiden Jahrzehnte nach 1918 nicht allein eine Nachkriegszeit, sondern ebensosehr eine Vorkriegszeit? Der Zusammenhang und die Wechselwirkung zwischen innenpolitischen Schwierigkeiten der Einzelstaaten und der sich wandelnden Staatenordnung Europas bilden den Schwerpunkt der Überlegunge...
Die instabile internationale Ordnung und die extreme innere Labilität der meisten europäischen Staaten kennzeichnen die Jahre zwischen den Weltkriegen. Horst Möller gelingt eine Darstellung dieser politisch vielfältigen und bewegten Zeit, indem er sich auf die wesentliche Frage konzentriert: Warum waren die beiden Jahrzehnte nach 1918 nicht allein eine Nachkriegszeit, sondern ebensosehr eine Vorkriegszeit? Der Zusammenhang und die Wechselwirkung zwischen innenpolitischen Schwierigkeiten der Einzelstaaten und der sich wandelnden Staatenordnung Europas bilden den Schwerpunkt der Überlegungen. Durch die Konzentration auf diese Fragestellung entsteht das Bild einer Zeit, die sich aufgrund der Fülle der politischen Ereignisse einer knappen Darstellung eigentlich entzieht. Die Betrachtung der sozialen und ökonomischen Faktoren, der Nationalitätenproblematik und der totalitären Ideologien stellen diese politischen Phänomene in den entsprechenden historischen Zusammenhang.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.