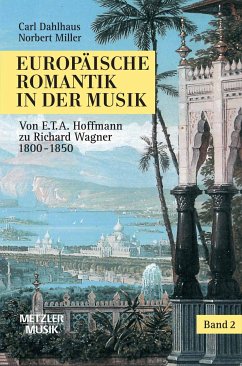Streifzug durch die Geschichte der Musik. Carl Dahlhaus und Norbert Miller erläutern, wie sich die traditionelle Opernform und der neue sinfonische Stil seit 1770 gegenseitig befruchten. Die Geschichte dieser Symbiose ist die Geschichte der klassisch-romantischen Musik als eine einheitliche Epoche. An ausgewählten Ereignissen werden die Umbrüche ebenso wie die kaum merkbaren Veränderungen sichtbar gemacht. Der zweite Band setzt in der Epochenmitte bei den Opern Webers und Spontinis ein. In Kapiteln über Rossinis Pariser Karriere, über Meyerbeer und die grand opéra, über Berlioz' und Schumanns Versuche einer "Opéra de concert" und über Verdis und Wagners musiktheatralische Neuerungen gehen die Autoren der Ästhetik der romantischen Oper und der Idee der symphonischen Dichtung auf den Grund.

Carl Dahlhaus ist der steinerne Gast auf Norbert Millers Opernbühne / Von Eleonore Büning
Zeit seines Lebens hat sich Carl Dahlhaus um präzise Kategorien bemüht. Sein Spezialgebiet war die Musik des neunzehnten Jahrhunderts und deren Pflege, mithin die Grundwurzel des modernen Musikdenkens - und die dabei wohl vertrauteste und vertrackteste, nie vollends zur Zufriedenheit gelöste Frage, die nach der musikalischen Romantik. Wo beginnt und wo endet sie? Und wie lappt sie ins Klassische, ihren Gegenpart, hinüber?
Faßt man Romantik als Epochenbegriff, passen die Zäsuren schlecht zusammen, denn die Musik ist, im Vergleich etwa zur Literatur und den übrigen schönen Künsten, bekanntlich spät dran. Definiert man die Romantik aber ästhetisch als Stil- oder Wertbegriff, wird das Dickicht der Deutungen schier unpassierbar. Beethovens Symphonien kamen Zeitgenossen wie E. T. A. Hoffmann wie der Inbegriff musikalischer Romantik vor, aber nicht anders erging es Mozarts "Don Juan" oder Glucks "Alceste". Chopins kurze Mazurken fallen ebenso ins romantische Fach wie Schuberts himmlische Längen, Bruckners eiserne Dreiklänge ebenso wie die Krise der Harmonik in Wagners Tristan. Das Problem mithin ist fast so alt wie die Musikwissenschaft selbst: Es reicht von den ersten "terminologischen Wucherungen" in den berühmten Vorlesungen zur Musikgeschichte, die Robert Schumanns Freund Franz Brendel 1851 in Leipzig hielt, über Alfred Einsteins elegant-dialektischen Eiertanz (New York, 1947) bis hin zum verschraubten Gestammel im neuesten, einschlägigen Artikel der Enzyklopädie "Musik in Geschichte und Gegenwart" (Kassel, 1998), welches in dem Geständnis gipfelt, man sehe sich "zum Verzicht" gezwungen, "die zentrale Frage, worin sich eigentlich in der Musikgeschichte bzw. in der Musik selbst Romantik äußere, mit bündigen Feststellungen zu beantworten".
Carl Dahlhaus hat das vor Jahren schon einmal besser gesagt. Er kam, nachdem er das Definitions-Dilemma aufsatzweise von allen Seiten beleuchtet hatte, im sechsten Band des Neuen Handbuchs der Musikwissenschaft zu der Erkenntnis: "Der Anspruch, Romantik in einen Begriff gefaßt zu haben, muß allerdings fallengelassen werden." Ein klares Wort ex cathedra, dem die Selbstkritik auf dem Fuße folgte: "Geschichtliche Komplexe", so Dahlhaus, "als Systeme beschreiben zu wollen, ist ein falscher Ehrgeiz von Historikern, die sich durch einen inadäquaten, zur Geschichte querstehenden Wissenschaftsbegriff haben einschüchtern lassen." Da reibt man sich doch erstaunt die Augen, wie jetzt, zehn Jahre nach dem frühen Tod des großen Forschers, ein neues, dickes Dahlhaus-Buch auf dem Tisch landen kann, erster Band einer großen Arbeit, die volltönend und frei nach René Wellek die "Europäische Romantik in der Musik" verhandelt.
Gleich auf den ersten Seiten wird wieder mit Kategorien gefuhrwerkt, von "Präromantik" bis "Neoklassizismus", letzteres gemünzt nicht etwa auf Strawinsky oder Hindemith, sondern auf den armen Christoph Willibald Gluck. Alsdann erhebt sich unversehens der Zeitraum von 1770 bis 1850 in den Rang einer Epoche, nebst "polemischer Unterordnung dieser Epoche unter die Romantik". Folgt der allfällige "Paradigmenwechsel" und Hauptgegenstand der Untersuchung: die Oper, wichtigste und stilbildende Gattung bis ins achtzehnten Jahrhundert, habe der sich emanzipierenden Instrumentalmusik und der im neunzehnten Jahrhundert zur dominanten Gattung aufsteigenden Symphonie weichen müssen. Es handelt sich dabei um eine recht teutonische These. Sie läßt sich nämlich nur halten, wenn man den romantischen Europablick fest auf Deutschland richtet und möglichst nicht an Verdi, Bellini, Donizetti, Rossini, Meyerbeer und die Folgen denkt. Laut Inhaltsverzeichnis geht es in diesem Buch freilich vor allem um die Opern Mozarts und Glucks, außerdem ist noch die Rede von da Ponte und Schikaneder sowie, recht "romantisch" und "europäisch", von weiteren Buffa- und Seriaopern aus Mozarts und Glucks Umfeld in Wien oder Paris.
Allerdings zeichnet Carl Dahlhaus nicht allein verantwortlich für Idee und Buch. Sein Co-Autor, der vergleichende Literaturwissenschaftler und fabelhafte Opernkenner Norbert Miller, hat den Löwenanteil der Kapitel verfaßt, darunter auch das theoretisch ausschweifende Vorwort, und zwar, wie verlautet, nach einer gemeinsam kurz vor Dahlhaus' Tod in Stichpunkten fixierten Skizze. Es wäre nützlich, könnte man das zehn oder zwölf Jahre alte Blatt im Anhang einsehen. Nicht als Reliquie, auch nicht zur Überprüfung der geistigen Eigentumsverhältnisse, vielmehr der editorischen Klärung halber: letztlich kommt es auch in der objektiven Wissenschaft darauf an, wer etwas wie subjektiv formuliert - und Millers redaktionelle Hinweise zu Planung und Genese dieses außergewöhnlichen Gemeinschaftswerks sind mehr als lakonisch.
Insgesamt hat Dahlhaus sechs kurzer Essais beigesteuert zu dem Projekt. Sie machen etwa vierzig von insgesamt sechshundert Seiten Text aus, die Anmerkungen nicht mitgerechnet, und handeln vom musikalischen Charakter, Melodie und Thema, vom Begriff der Besonnenheit, von der Tonartendisposition in Mozarts Arien, der Sonatenform und der teleologischen Zeitstruktur von Symphonien, und was dergleichen klassische Dahlhausthemen mehr sind. Wie Inseln ragen seine geschliffenen Pointen in den breiten Strom der Millerschen Prosa. Der seinerseits hat sein Libretto-Schränkchen weit geöffnet und schüttet füllhornweise überreiche Opernkenntnisse über den Leser aus. Von einem "Dialog" zwischen den beiden Autoren, einer "kontroversen Debatte" gar, kann keine Rede sein.
Über weite Strecken gleicht das Buch einem elaborierten Opernführer für Fortgeschrittene. Lesenswert sind darin vor allem die Auslassungen zu den kaum abgegrasten Terrains, etwa die Beschreibung der Opern von Peter von Winter, Martin y Soler, Johann Christoph Vogel und Cimarosa, aber auch zwei umfängliche Kapitel zum Opernschaffen Joseph Haydns. Gern und mit Gewinn mag man sich auch noch einmal vertiefen in eine Exegese der Abschiedsszene aus Mozarts "Cosí fan tutte" oder in den Vergleich der Unterwelts-Szenen aus beiden Fassungen der Gluckschen "Alceste". Das europäisch-romantische Getöse aber, von dem im Vorwort die Rede war, geht gottlob im Detail verloren, nicht einmal ein rosa Fädchen des Konzepts ist noch zu sehen. Und daß die Entwicklung der Gattung vom Gluckschen Ideal der dramatischen Reformoper über die Nummernoper zum Musikdrama führt, versteht sich wohl von selbst.
Man sollte also den Überbau, der sich über Vorwort, Titel und Klappentext wölbt und wölkt, nicht zu ernst nehmen. In gewisser Weise verdankt er sich einer Überidentifikation mit dem Gegenstand. Tatsächlich waren ja zu Beginn des vorigen Jahrhunderts der Höhenflug der (deutschen) Instrumentalmusik und der Rang der Vokalmusik, der Kampf gegen die alte (welsche) Oper und der Ruf nach einer neuen (deutschen) National-Oper, aber auch die Frage nach dem Sprachcharakter und Formensprache der absoluten Musik in den deutschen Musikjournalen hitzig diskutierte Probleme. Miller begibt sich mithin in den Blickwinkel der Biedermeierzeit, er entwirft die Musikgeschichte noch einmal vor- und rückwärts durch die Brille von E. T. A. Hoffmann, Amadeus Wendt und Adolf Bernhard Marx: Chopin und Schubert, Bellini und Donizetti, erst recht Bruckner und Verdi kommen in dieser Sicht (noch) nicht vor.
Selbst die (redigierten?) Dahlhaus-Passagen scheinen von solchen Anfechtungen nicht frei. Ob sie würdig sind, demnächst in die auf zwanzig Bände projektierte Dahlhaus-Schriften-Reihe des Laaber-Verlags aufgenommen zu werden, steht dahin. In einem frühen Planungsstadium hatten Miller und Dahlhaus ihr disparates Buchprojekt jedenfalls noch schlicht und allgemein "Sprechende Musik" nennen wollen. Passender wär es gewesen.
Carl Dahlhaus, Norbert Miller: "Europäische Romantik in der Musik". Band 1: Oper und sinfonischer Stil 1770-1820. J. B. Metzler Verlag, Stuttgart 1999. VI, 850 S., 73 Abb., geb., 148,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
"Großes Buch", lautet Jens Malte Fischers begeistertes Resümee zu diesem voluminösen zweiten Band der von Carl Dahlhaus und Norbert Miller verfassten Darstellung "Europäische Romantik in der Musik". Zwar kann Fischer hier keine Apotheose Richard Wagners (wie er sie durch den Untertitel in Aussicht gestellt sieht) entdecken, dafür aber sieht er seine weiteren Erwartungen übertroffen. Nicht nur überwältigt ihn das Buch mit seiner schieren Materialfülle und überflügelt es in seinen Augen alles bisher zum Thema Erschienene, es bedeutet ihm auch neue Schwerpunkte. E. T. A. Hoffmann als Opernkomponist und "Pol der Romantik" beispielsweise. Oder Berlioz und Liszt als "zentrale Gestalten" der europäischen Romantik. Die Art der Präsentation findet Fischer zudem dazu angetan, den Leser zu begeistern, mitzureißen und mit Wissen zu beglücken. Auch wenn das Buch, wie er erklärt, stilistisch stark zwischen Skizzenhaftem und "vollhändigem Ausschenken" großer Kenntnisse changiert.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Schwere Kost, aber prall gefüllt mit wertvollem Wissen." clarino.print