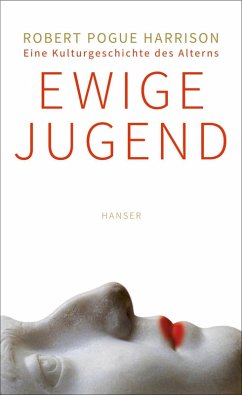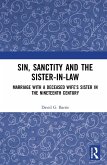Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Ist es wirklich eine gute Nachricht, wenn eine Frau über fünfzig das sogenannte Bond-Girl spielt? Tun wir das Richtige, wenn wir unsere Jugend unendlich zu verlängern suchen? Nein, sagt der Autor Robert Pogue Harrison, mit dem Alter schaffen wir auch die Zukunft ab
Unter den wenigen guten Nachrichten, die uns in diesen Wochen erreichen, ist diese hier womöglich die relevanteste: Monica Bellucci, geboren am 30. September 1964, spielt in "Spectre", dem neuen James-Bond-Film, das sogenannte Bond-Girl - eine Rolle also, welche dadurch definiert ist, dass diese Frau den Helden verlocken, verführen, womöglich in Gefahr bringen soll, was im Kino nur dann funktioniert, wenn sie auch auf die Zuschauer verlockend, verführerisch und gefährlich wirkt.
Eine 50-Jährige in einer Rolle, für die es doch in den Karteien der Schauspielagenturen genügend 30-Jährige gäbe: Das wäre noch zu der Zeit, als Monica Bellucci ihr Abitur machte, fast unmöglich gewesen. Als, nur zum Beispiel, Jacqueline Bisset 1983, in dem Film "Class", die reife Frau spielte, die sich mit dem College-Freund ihres Sohnes einlässt, war sie gerade 39 Jahre alt.
Wenn die 50-jährige Monica Bellucci das Bond-Girl glaubhaft verkörpern kann, dann hat sich entweder das 50-Jahre-alt-Sein oder unsere Wahrnehmung dieses Alters verändert. Entweder sind also die 50-Jährigen heute so jung, wie es 50-Jährige niemals zuvor waren. Oder wir, die alternde Gesellschaft, haben unser Schönheitsideal dem demographischen Trend angepasst und finden attraktiv und begehrenswert, was eine Generation vor uns die Leute noch kalt gelassen hätte.
Man muss Monica Bellucci nur dabei zuschauen, wie sie sich selber oder irgendeine Rolle spielt, um zu erkennen, dass beides stimmt: Sie will ja gar nicht so tun, als ob sie 35 wäre; ihren Zügen sieht man an, dass sie ein paar Jahre mehr gelebt, ein paar Erfahrungen mehr gemacht hat. Aber dieses Gesicht ist nicht müde oder grau geworden mit den Jahren, auch nicht altersmild, weise, abgeklärt; schon eher ist es jugendlich geblieben - und hat zugleich an Reife gewonnen. Womit sich jener Wandel des Schönheitsideals erklärt, der sich auch an den Rollen und Erfolgen von Julianne Moore (54), Juliette Binoche (51) oder Meryl Streep (66) ablesen lässt. Wenn die alten Schachteln so jugendlich, aktiv und attraktiv bleiben, dann wirkt die Schönheit noch der schönsten jungen und unerfahrenen Dinger dagegen flach und unbedeutend.
Im Massenmedium des Films, am Beispiel von Schauspielerinnen, auf deren Attraktivität sich die halbe Welt einigen kann, wird nur besonders deutlich sichtbar, welche Veränderung die Bewohner all jener Gegenden erfasst hat, in denen es gesunde Ernährung und gute Ärzte, Yogakurse, Fitnessgeräte und ausreichend Mineralwasser gibt (und, falls unbedingt nötig, Botox, Viagra, plastische Chirurgie): Das Alter als Lebensabend und Ruhestand, das Lebensdrittel, in welchem, wie es im Rätsel der Sphinx hieß, der Mensch ein Wesen mit drei Beinen ist, wird abgeschafft zugunsten einer Jugendlichkeit, die dauern will, bis schwere Krankheit oder Tod sie beenden. Mag sein, dass der eine oder andere sich nach weisen, abgeklärten Omas und Opas sehnt (die bizarre Verehrung für Helmut Schmidt, der sein eigenes Greisenalter überlebt hat und wie ein Zeitreisender aus einer verlorenen Vergangenheit durch unsere Gegenwart geistert, zeugt davon) - vor die Wahl gestellt, ob er endlich alt sein oder jung bleiben möchte, entscheidet sich fast jeder für mehr Sonnengrüße und Gemüse-Smoothies und weniger Whisky und schwört, dass er nicht abgeklärt, weise und ein bisschen müde sei, sondern neugierig, aktiv und extrem gut drauf.
Und genau das ist der Moment, in dem Robert Pogue Harrison all den jugendlichen Alten die Laune verderben möchte. Harrison, der italienische und französische Literatur in Stanford lehrt, hat über das Thema "Wie alt sind wir?" einst einen wundervollen Essay im "Merkur" geschrieben (im Doppelheft 2001, das dann alle für ungültig hielten, weil zwischen Redaktionsschluss und Erscheinen sich der 11. September ereignete) und einen Vortrag an der Münchner Siemens-Stiftung gehalten, und wenn man ihn damals, so ums Jahr 2005 herum, fragte, wann er daraus ein Buch machen werde, hieß die Antwort: nie. Jetzt hat er es doch getan, und die These dieses Buchs, das, sarkastisch, "Ewige Jugend" heißt, lässt sich in wenigen Sätzen referieren: Wenn wir das Alter abschaffen, schaffen wir damit zugleich die Jugend ab. Wenn wir Erfahrung und Erinnerung, das Gedächtnis der Toten und das Bewusstsein davon, dass wir sind, wer wir sind, weil wir eine Vergangenheit und eine Geschichte haben, all das also, was wir normalerweise dem Alter zuordnen, so radikal entwerten, wie es zurzeit geschieht: Dann nehmen wir uns selbst auch die Möglichkeit der Zukunft. Dann schließen wir uns ein ins Gefängnis einer Gegenwart ohne Tiefe und Grund. Dann ist die Zeit aus den Fugen. Wir müssen alt werden, schreibt Harrison im Vorwort, damit wir die Jungen zu Erben der Geschichte machen können. Andernfalls machen wir sie zu Waisen, denen die Vergangenheit kein Vermächtnis, sondern eine fremde, unverständliche Welt ist. Und die Zukunft nichts, worauf sie sich berufen und beziehen könnten.
Der englische Kulturwissenschaftler Mark Fisher hat neulich (in "Gespenster meines Lebens") die Frage gestellt, wie uns, während das Silicon Valley an der Totalkolonisierung der Welt durch den Cyberspace arbeitet, zugleich die Zukunft so total verlorengehen konnte: Wer mit der Musik, der Kleidung, dem Habitus von heute zurückreiste in der Zeit, fünfzehn, zwanzig Jahre vielleicht, würde niemanden erschrecken. Sieht alles genauso aus, klingt so, fühlt sich so an. Und die kulturelle Produktion der Gegenwart, die uns, irgendwie, nostalgisch erscheint, hat nicht etwa einen echten Anker in der Vergangenheit; sie hat sich nur aus der Zeitgenossenschaft verabschiedet in ein pseudohistorisches Nirgendwo.
Fisher macht in seinem Essay den Neoliberalismus, Margaret Thatcher und die Gentrification der Kunstmetropolen für diesen Stillstand der Zeit verantwortlich, was nicht sehr überzeugend ist. Harrisons Erklärung ist wesentlich stringenter; man muss allerdings einen kleinen Umweg über die Evolutionsbiologie machen. Harrison beruft sich auf Stephen Jay Goulds Standardwerk "Ontogeny and Phylogeny", wenn er den Menschen als neotenisches Wesen beschreibt. Neotenie heißt Verzögerung, und dass aus dem Affen ein Mensch wurde, das kommt daher, dass dessen Entwicklung so langsam geschieht, dass Kopf und Gehirn größer werden konnten und die Lernphase so lange anhält, dass der Mensch seinen Instinkten nicht mehr ausgeliefert ist wie ein Tier. Es ist die Jugendlichkeit, die unendlich verzögerte Juvenilität, welche den Menschen vom Affen unterscheidet. Der Mensch, so kann man sagen, ist ein geschlechtsreif werdendes Affenbaby.
Neotenie, sagt aber Harrison, sei auch das entscheidende Merkmal der menschlichen Kultur. Jeder Umsturz, jede Revolution, jeder neue Stil, jede neue Erkenntnis verdanke sich letztlich dem Umstand, dass einer, eine Gruppe, vielleicht auch eine ganze Gesellschaft sich geweigert habe, erwachsen zu werden. Die Evangelien fordern die Gläubigen dazu auf, wie Kinder sich ihrem Gott anzuvertrauen, und es war diese Jugendlichkeit, die dem Christentum zum Durchbruch verhalf im spirituell uralten Römischen Reich. Die ersten Reisenden aus dem gotischen Frankreich, die in Italien den neuen Stil kennenlernten, waren ganz erschüttert angesichts der frivolen Jugendlichkeit der Renaissance. Albert Einstein behauptete sein Leben lang, nur weil er innerlich ein Kind geblieben sei, habe er so ungeheuer neue Gedanken denken können. Um nur einige von Harrisons Beispielen zu referieren.
Harrison (beziehungsweise sein deutscher Übersetzer) nennt, was da am Werk ist, das Genie des Menschen. Ohne dieses Genie, das nichts als gegeben hinnimmt, um alles radikal neu zu denken, zu formen, ohne diese absolute Jugendlichkeit gebe es weder Sprache noch Kultur, keine Kunst, keine Technik, keinen Fortschritt in irgendeiner Wissenschaft.
Allerdings, das ist Harrisons zentraler Gedanke, gebe es das alles auch nicht ohne die gewissermaßen entgegengesetzte Eigenschaft, die er Weisheit nennt und dem Alter zuordnet. Die Weisheit, so beschreibt es Harrison, ist nicht einfach der Feind alles Neuen, der Verteidiger der bestehenden Verhältnisse. Die Weisheit, die er als Bewusstsein von Herkunft und Tradition beschreibt, als das dauernde Gespräch mit jenen Toten und Vergangenen, ohne die unsere Existenz in der Gegenwart nicht verständlich wäre, diese Weisheit ist auch dazu da, das radikal Neue zu übersetzen in verständliche Begriffe und einzureihen in die Tradition, ja ihm überhaupt erst einen Platz zu schaffen im Kontext der Gegenwart, damit daraus nicht nur Bruch, Umsturz, Zerstörung, sondern eine Zukunft werde. Es ist, was der junge Marx im "18. Brumaire des Louis Bonaparte" beschrieb, nur ohne dessen jugendliche Arroganz: "Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen. Die Tradition aller toten Geschlechter lastet wie ein Alp auf dem Gehirne der Lebenden. Und wenn sie eben damit beschäftigt scheinen, sich und die Dinge umzuwälzen, noch nicht Dagewesenes zu schaffen, gerade in solchen Epochen revolutionärer Krise beschwören sie ängstlich die Geister der Vergangenheit zu ihrem Dienste herauf, entlehnen ihnen Namen, Schlachtparole, Kostüm, um in dieser altehrwürdigen Verkleidung und mit dieser erborgten Sprache die neuen Weltgeschichtsszenen aufzuführen. So maskierte sich Luther als Apostel Paulus, die Revolution von 1789-1814 drapierte sich abwechselnd als römische Republik und als römisches Kaisertum."
Harrisons Gegenüberstellung von Genie und Weisheit ist ein Modell, kein empirisch nachweisbarer Sachverhalt - aber wie tauglich es ist, zeigt sich, nur zum Beispiel, wenn man, mit Mark Fishers Frage im Kopf, wo die Zukunft geblieben sei, noch einmal hineinschaut in den Cyberspace. Es ist ganz sicher Genie, was Google oder Apple dazu treibt, das Auto, das Haus, die Gesellschaft gewissermaßen völlig neu, ohne Rücksicht auf Geschichte und Herkunft, noch einmal starten zu wollen. Und dass sich daraus trotzdem keine Zukunftsperspektive ergibt, kein Ziel, das man hoffnungsfroh avisieren wollte, nur immer neue, immer fremder und körperloser werdende Gegenwart: Das liegt an der Weisheit, die es einfach nicht schafft, das Wissen aus dem Silicon Valley zu übersetzen und einzuordnen, mit der Tradition von Demokratie und Menschenrechten so zu verknüpfen, dass wir, ohne Panik und Dauerüberforderung, uns darüber verständigen könnten, welche Zukunft wir mit dieser Technik ansteuern wollen.
Wenn wir aber nicht älter werden wollen, dann werden wir auch nicht weise, sagt Harrison, der auch die Geschichte von Ödipus nicht bloß als Drama von Vatermord und Inzest liest, sondern vor allem als Warnung vor einer Gesellschaft, in der alle gleichermaßen jung sind, alterslos gewissermaßen, so dass die Mutter von der Geliebten, die Tochter von der Schwester nicht mehr zu unterscheiden ist.
Es ist keine schlechte Nachricht, dass Monica Bellucci und ihre Schwestern und Brüder eher jung sind als alt; dass sie für die Jugendlichkeit eine neue Ausdrucksform gefunden haben. Die schlechte Nachricht wäre es aber, wenn wir darüber vergäßen, dass dem auch eine neue Form fürs Altsein entsprechen muss.
CLAUDIUS SEIDL
Robert Pogue Harrison: "Ewige Jugend". Hanser-Verlag, 288 Seiten, 24,90 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH