Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.

Individuelle Freiheit und politische Ordnung: Jens Hacke würdigt die liberalen Denker der Weimarer Republik
Eine Besonderheit der deutschen Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts besteht darin, dass es in ihr keine Phase gibt, die man als Regierungszeit des Liberalismus bezeichnen könnte. Auch das Zweckbündnis Bismarcks mit den Liberalen zerbrach, ehe sie sich darüber verständigen konnten, was es bedeutete, im Besitz der Macht zu sein.
Der Politikwissenschaftler Jens Hacke formuliert das in seiner höchst lesenswerten Untersuchung über die politische Theorie des Liberalismus in der Zwischenkriegszeit so: "Es hatte die klassische bürgerliche Demokratie in Deutschland bis dato gar nicht gegeben, allenfalls demokratische Elemente; trotzdem galt die Weimarer Republik bereits als demokratische Staatsform einer postbürgerlichen Epoche." Was für den politischen Liberalismus eine folgenreiche Belastung war, begründet zugleich eine eigentümliche theoretische Spannung, von der das Buch lebt. Schließlich sollte eine politische Theorie in der Opposition halbwegs systematisch ausfallen. Den englischen Pragmatismus hat der deutsche Liberalismus immer bewundert, aber selbst nie erreicht.
Dass dieses Kapitel der politischen Ideengeschichte Deutschlands vergleichsweise vergessen war, ist im Grunde verblüffend. Denn nach dem Ende des Ersten Weltkriegs machte der Liberalismus eine ganz ähnliche Erfahrung wie der Konservativismus: Er verlor die Wirklichkeiten, auf die er sich zu beziehen pflegte. Den Liberalismus trafen die Zäsuren der Jahre 1914 und 1918, wie Hacke zeigt, sogar besonders hart: Das allgemeine Wahlrecht erledigte den Liberalismus als Legitimationsideologie einer bürgerlichen Klassenherrschaft und zwang seine Verfechter, ihre Affekte gegen die Massendemokratie zu überdenken.
Die staatliche Wirtschaftslenkung der Kriegs- und Nachkriegszeit und die stetig expandierende Sozialpolitik demonstrierten die Abhängigkeit moderner Gesellschaften von staatlicher Intervention. Die staatliche Wirtschaftslenkung der Kriegs- und Nachkriegszeit, die stetig expandierende Sozialpolitik und die faktische Aufhebung des Goldstandards demonstrierten die Abhängigkeit moderner Gesellschaften von staatlicher Intervention. Die Erfahrungswelt des Jahres 1918 besaß wenig liberale Evidenz.
Der Zufall wollte es dann, dass die liberalen Heroen der Weimarer Gründungsjahre ohne Ausnahme früh starben: Max Weber ebenso wie der Verfassungsvater Hugo Preuß, Ernst Troeltsch, Walther Rathenau und Gustav Stresemann. Mitte der zwanziger Jahre wird die Geschichte, die Hacke erzählt, deshalb kleinteiliger, aber gerade darum originell. Manchen Denker holt Hacke überhaupt erst aus dem Schatten der großen fünf heraus.
Das gilt etwa für Karl Loewenstein und seine bahnbrechenden Überlegungen zur "wehrhaften Demokratie" oder die frühen Analysen der faschistischen Herrschaftstechnik und des Korporatismus der deutschen Volkswirtschaft durch Moritz Julius Bonn, in gewisser Weise Hackes Schlüsselautor.
Die Hegemonie des Antiliberalismus machte die liberalen Denker zu scharfsinnigen Beobachtern ihrer Zeit. Doch Hacke schreibt dem Liberalismus zwischen den Kriegen zugleich eine bedeutende theoriegeschichtliche Leistung zu. Sie bestand darin, das Prinzip der individuellen Freiheit mit den Institutionen der Weimarer Demokratie zusammenzudenken. Liberalismus sollte sich nicht mehr in Eigentumsschutz und Gesetzmäßigkeit erschöpfen, sondern im Kern liberale Demokratie sein. Dass es nach dem Zweiten Weltkrieg lange keine Liberalen mehr gab, die die parlamentarische Demokratie nicht akzeptierten, war demnach eine Errungenschaft der Zwischenkriegszeit und nicht erst, wie man es ein ums andere Mal erzählt hat, Folge der NS-Zeit.
Als eine theoretische Leistung wird man diese Entwicklung allerdings nur bedingt würdigen können. Dass individuelle Freiheit und politische Ordnung nur über vernünftige Institutionen dauerhaft vermittelt werden können, war den englischen und französischen Liberalen des neunzehnten Jahrhunderts recht geläufig. Ökonomische ohne politische Freiheit war vielmehr das höchst spezielle Arrangement des deutschen liberalen Bürgertums mit dem Kaiserreich. Diese fragwürdige Vorgeschichte des deutschen Liberalismus kommt bei Hacke in ihrer langfristigen Bedeutung vielleicht etwas zu kurz.
Die Frage ist aber: Trägt der ausgebreitete Quellenbefund eigentlich die These? Das Beharren auf Ausgleich, Kompromiss und Verfahren ist noch keine Theorie des Parlamentarismus im Wohlfahrtsstaat und in der Massendemokratie. Eine präzise Konzeption von parlamentarischer Herrschaft besaß von Hackes Autoren vor allem Max Weber, der dann aber überraschend schlecht wegkommt. Außerdem der Staatsrechtslehrer Richard Thoma, der Webers Theorie parlamentarischer Herrschaft in eine bis heute faszinierende Interpretation des Weimarer Regierungsgefüges goss.
Dagegen stand der Staatsrechtler Hans Kelsen in seinen demokratietheoretischen und politischen Schriften der zwanziger Jahre zwar sicherlich "dem heutigen Verständnis einer pluralistischen Parteiendemokratie mit parlamentarischem Repräsentativsystem am nächsten", doch stand auch er für eine Verfassungsordnung, die jenseits der Weimarer Institutionen lag.
Politische Ideologien entwickeln an ihrer eigenen Geschichte vornehmlich in Phasen der Schwäche Interesse. Hacke will sein Buch, eine Gegenerzählung zu der inzwischen sehr intensiv erforschten Geschichte des politischen Extremismus in der Zwischenkriegszeit, explizit als Beitrag zur theoretischen Erneuerung des Liberalismus verstanden wissen. Doch während der Rechts- und Linksradikalismus mit Theoremen der Zwischenkriegszeit immer noch üppige Erträge erwirtschaftet, ist das in diesem Fall schwieriger.
Ob die Ideengeschichte zur Erneuerung politischer Ideologien überhaupt etwas Ernsthaftes beitragen kann, sei dahingestellt. Vor allem aber ist die Situation des Weimarer Liberalismus mit der des heutigen nicht vergleichbar: Denn Ersterer hatte den Liberalismus des Kalten Krieges - das heißt: den Prozess der Liberalisierung der westlichen Gesellschaften - noch vor sich.
FLORIAN MEINEL
Jens Hacke: "Existenzkrise der Demokratie". Zur politischen Theorie des Liberalismus in der Zwischenkriegszeit.
Suhrkamp Verlag,
Berlin 2018.
455 S., br., 26,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

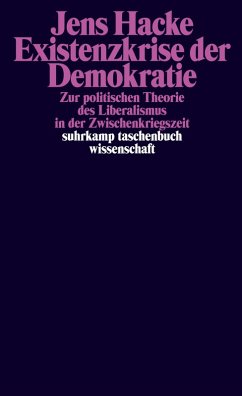







![Lohn, Preis und Profit. [Was bedeutet das alles?] (eBook, ePUB) Lohn, Preis und Profit. [Was bedeutet das alles?] (eBook, ePUB)](https://bilder.buecher.de/produkte/57/57794/57794963m.jpg)