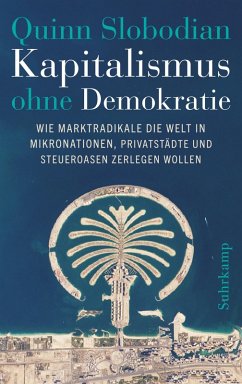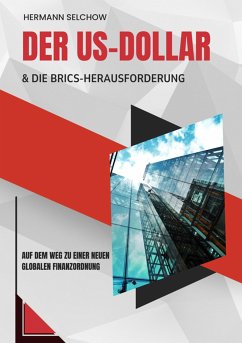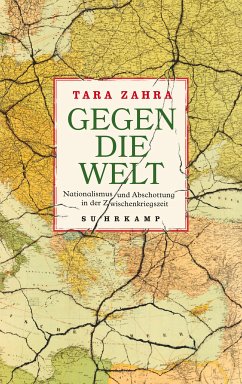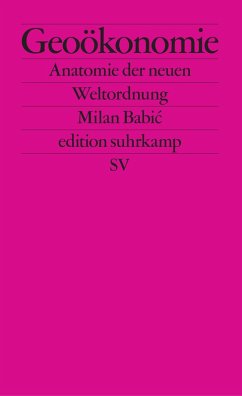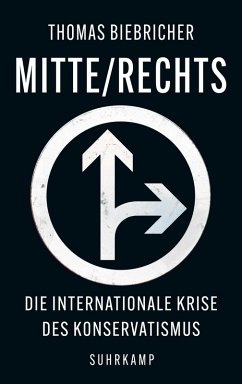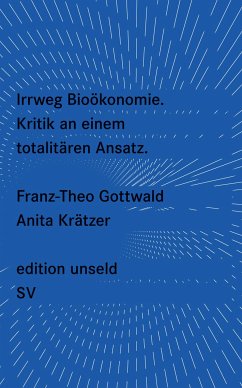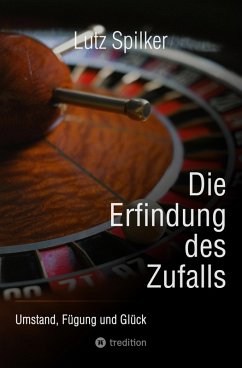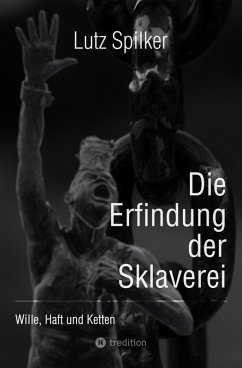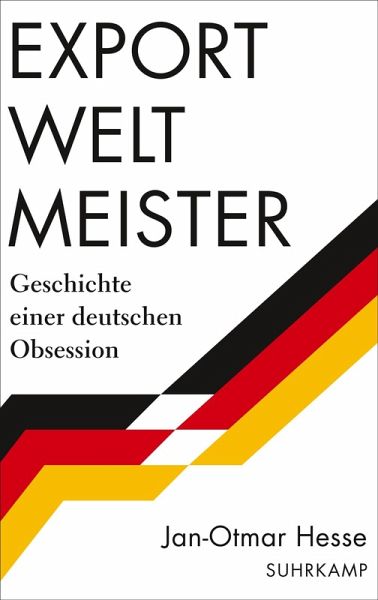
Exportweltmeister (eBook, ePUB)
Geschichte einer deutschen Obsession Von der verspäteten Nation zur wirtschaftlichen Weltmacht - eine deutsche Geschichte
Sofort per Download lieferbar
Statt: 28,00 €**
23,99 €
inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.
**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Im WM-Finale 1986 musste sich die DFB-Elf der argentinischen Auswahl um Diego Maradona mit 2:3 geschlagen geben. Trotzdem durften sich die Westdeutschen als Weltmeister fühlen, denn in diesem Jahr exportierte die Bundesrepublik erstmals mehr Güter als jeder andere Staat. Das Land war »Exportweltmeister« - Champion in einer Disziplin, die nicht nur das Fundament für unseren Wohlstand bildet: Die deutsche Exportstärke ist Bestandteil des Nationalstolzes und Hinweis auf den exzellenten Ruf der Waren »Made in Germany«. Der Wirtschaftshistoriker Jan-Otmar Hesse begibt sich auf die Spuren di...
Im WM-Finale 1986 musste sich die DFB-Elf der argentinischen Auswahl um Diego Maradona mit 2:3 geschlagen geben. Trotzdem durften sich die Westdeutschen als Weltmeister fühlen, denn in diesem Jahr exportierte die Bundesrepublik erstmals mehr Güter als jeder andere Staat. Das Land war »Exportweltmeister« - Champion in einer Disziplin, die nicht nur das Fundament für unseren Wohlstand bildet: Die deutsche Exportstärke ist Bestandteil des Nationalstolzes und Hinweis auf den exzellenten Ruf der Waren »Made in Germany«. Der Wirtschaftshistoriker Jan-Otmar Hesse begibt sich auf die Spuren dieses Erfolgs, der sich einer erstaunlichen Anpassungsfähigkeit deutscher Unternehmen und einer exportfreundlichen Politik verdankt. Schon Ende des 19. Jahrhunderts wurden wichtige Weichen gestellt. Die Weimarer Republik schuf die ersten Instrumente zur Unterstützung der Exportwirtschaft. Die Geldpolitik der Nachkriegszeit stärkte ihre globale Wettbewerbsfähigkeit. Fesselnd und mit vielen bislang unbekannten Details berichtet Exportweltmeister davon, wie aus Werkstätten und Manufakturen Global Player und aus einem rohstoffarmen Land die ökonomische Supermacht wurde, die es heute ist.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.