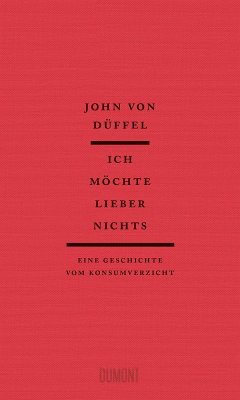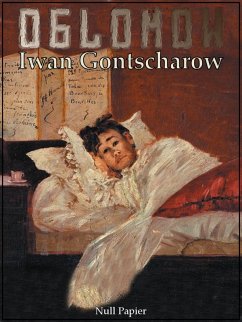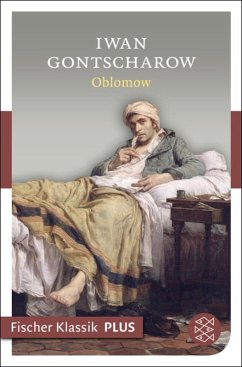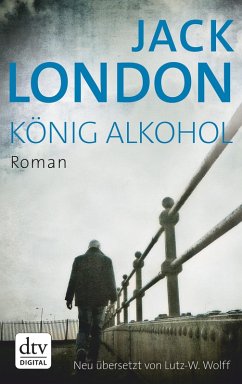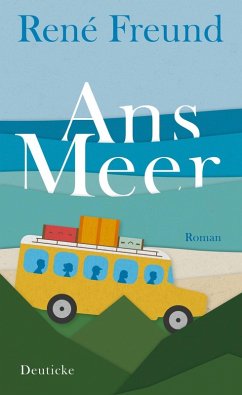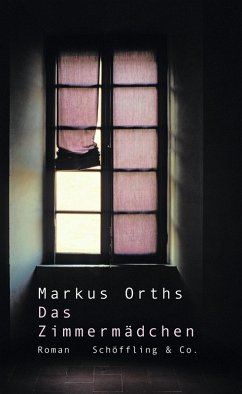Fernsehen (eBook, ePUB)
Versandkostenfrei!
Sofort per Download lieferbar
9,99 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Sommer in Berlin. Ein Kunsthistoriker, der dank eines Stipendiums einige Monate in einer großen Berliner Wohnung verleben darf und dessen Familie ihren Urlaub in Italien verbringt, will die Gelegenheit nutzen, sich seiner lang aufgeschobenen Studie über Tizian zu widmen. Doch stattdessen verbringt er Stunden vor dem Fernseher. Als er seine innere Trägheit durchschaut, entschließt er sich schweren Herzens, den Fernsehapparat für immer abzuschalten. Eine harte Probe seiner Selbstdisziplin, denn er ist geradezu süchtig nach Sportsendungen aller Art. Die fernsehlose Zeit bekommt ihm gar nich...
Sommer in Berlin. Ein Kunsthistoriker, der dank eines Stipendiums einige Monate in einer großen Berliner Wohnung verleben darf und dessen Familie ihren Urlaub in Italien verbringt, will die Gelegenheit nutzen, sich seiner lang aufgeschobenen Studie über Tizian zu widmen. Doch stattdessen verbringt er Stunden vor dem Fernseher. Als er seine innere Trägheit durchschaut, entschließt er sich schweren Herzens, den Fernsehapparat für immer abzuschalten. Eine harte Probe seiner Selbstdisziplin, denn er ist geradezu süchtig nach Sportsendungen aller Art. Die fernsehlose Zeit bekommt ihm gar nicht gut. Gefühle von Entbehrung bis hin zu diffusem Schmerz stellen sich ein. Statt fernzusehen gibt der Held sich nun bereitwillig und auf seine somnambule Art dem Müßiggang im sommerlichen Berlin hin, unternimmt Ausflüge an Badeseen, besucht Museen und Cafés. Und er verabredet sich, zum Beispiel mit dem Literaten und von ihm beneideten Frauenhelden John Dory, zu einem Ausflug in den tiefen Osten, der in einem Rundflug über ganz Berlin mündet. Sein Versagen an der Wirklichkeit kommt ihm schlagartig in den Sinn, als ihm einfällt, dass er völlig vergessen hat, die Blumen seiner Nachbarn, der Dreschers, den Sommer über wie versprochen zu gießen.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.