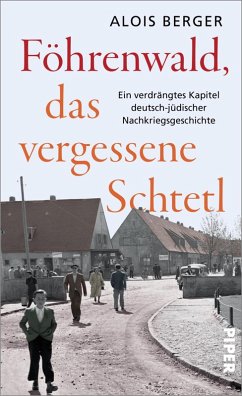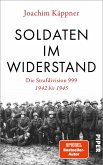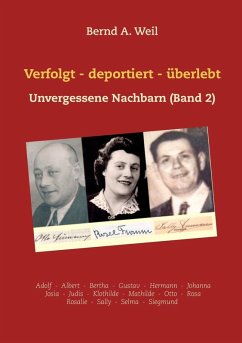Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Schikaniert von der Polizei, bedroht von Seuchen und Hunger: Alois Berger rekapituliert die Geschichte des Lagers Föhrenwald
Man kann es mit Umbenennung versuchen. Manchmal klappt das eine Weile, aber irgendwann kommt jemand und will es genauer wissen. So auch in Waldram, einem Stadtteil von Wolfratshausen. Während des Zweiten Weltkriegs entstand hier eine Wohnsiedlung für die Arbeiter der Rüstungsindustrie. Später kamen Zwangsarbeiterinnen hinzu, von den Einheimischen "Kanarienvögel" genannt, weil das Hantieren mit Giftstoffen ihre Haut und Haare gelb gesprenkelt hatte. Juden tauchen in dieser Geschichte erst auf, als die Nationalsozialisten die letzten KZ-Insassen aus Dachau auf den Todesmärschen in Richtung Gebirge trieben.
Die Alliierten hatten schon während des Krieges für verschleppte und gestrandete Zivilisten, die nicht in ihre Heimat zurückkehren konnten, den Begriff "Displaced Persons" (DP) gewählt. Viele Osteuropäer wollten nicht zurück, ihr Hass auf Deutschland besiegte nicht die Angst vor Stalin, der sie mit dem Generalverdacht, sie seien Kollaborateure gewesen, bedrohte. Auf Betreiben der amerikanischen Besatzungsmacht wurden in Bayern Juden in eigenen DP-Lagern untergebracht. So kam es, dass aus der nationalsozialistischen Mustersiedlung das Lager Föhrenwald wurde, das größte Schtetl Europas, in dem mehrere Tausend Juden lebten. Nie zuvor, schreibt Alois Berger in seiner Recherche, habe es so viele Juden in Bayern gegeben wie 1947 - "zwei Jahre nach dem Ende der Judenvernichtung".
Föhrenwald war das am längsten existierende Lager. 1957 wurde das Areal an die katholische Kirche verkauft, die dort ausschließlich katholische Familien mit möglichst vielen Kindern ansiedelte. Die Juden wurden verdrängt, zur Übersiedlung nach München, Frankfurt und Düsseldorf gezwungen; die Straßen des "Judenlagers" wurden umbenannt, der Ortsname geändert. Waldram, das war der Name des ersten Abts von Kloster Benediktbeuern. Dann begann das kollektive Beschweigen.
Indem er diese Geschichte aufschrieb, verlieh der 1957 in Wolfratshausen geborene Journalist Alois Berger - er arbeitete viele Jahre als Korrespondent für verschiedene Medien in Brüssel - seiner "Fassungslosigkeit" Ausdruck. Selbst streng katholisch erzogen, treibt ihn die Frage um: Woher kommt dieser blinde Fleck in der eigenen Geschichte? Denn anders als am Ort des Geschehens ist die Geschichte Föhrenwalds in der internationalen Forschungsliteratur gut dokumentiert. Und anders als die Deutschen, die dieses Kapitel verdrängten, haben alle, die je in Föhrenwald lebten, ihre Zeit dort nie vergessen, auch wenn sich in ihren Erzählungen unterschiedliche Wahrnehmungen zeigen.
Berger hat fünfzig Interviews mit Zeitzeugen in Israel und Deutschland geführt. Er gibt ihren Erinnerungen Raum, auch wenn sich diese gelegentlich in den Befunden wiederholen. Zunächst war Föhrenwald ein Sammelbecken für das Ostjudentum, das dort endlich wieder ungehindert seinen Glauben inklusive aller religiösen Riten leben konnte - mithilfe von "Shabbes-Gojim", deutschen Mädchen, die am Schabbat in den Rabbiner-Wohnungen Feuer machten und dafür sorgten, dass es nicht ausging.
Diese patriarchale Kultur des Schtetls kam unter Druck, als der Zionismus immer mehr Anhänger gewann. Föhrenwald wurde, zumal von 1948 an, dem Jahr der Staatsgründung Israels, zum "Wartesaal" für Auswanderer. Dabei prallten im Lager die Anhänger des chassidischen "Rebbe von Klausenburg", Yekusiel Yehuda Halberstam, dessen Frau und zehn seiner elf Kinder die Nazis ermordet hatten, mit den Parteigängern des liberalen Gedalyahu "Gustav" Lachman aufeinander, der im Zionismus die Zukunft sah. Sein Ziel war es, möglichst viele (junge) Juden nach Israel zu bringen.
Der Autor unternimmt Exkurse in die an grausamen Widersprüchen kaum zu überbietende Geschichte des jüdischen Neuanfangs, berichtet von einem Trainingscamp der paramilitärischen Untergrundorganisation Haganah im benachbarten Königsdorf. Er berichtet über den Besuch Ben Gurions, der vorschlug, die Gegend rund um Starnberger See und Ammersee in ein neues Israel zu verwandeln. Er zeigt den Slalomkurs deutscher Politiker und Behörden im Umgang mit der Besatzungsmacht, verfolgt braune Kontinuitäten, wie sie sich etwa in der Person des bayerischen Innen-Staatssekretärs und späteren Bundesministers für die Angelegenheiten der Vertriebenen, Theodor Oberländer, kristallisierten.
Berger erinnert stets daran, wie prekär die Lage der Föhrenwalder war, schikaniert von der Polizei, bedroht von Seuchen und Hunger. Anhand von Einzelschicksalen evoziert er die Atmosphäre im Lager, so etwa in der Person des ehemaligen F.A.Z.-Redakteurs Anton Jakob Weinberger, der schildert, wie die Juden gegen die Sudetendeutschen ausgespielt wurden. Nach dem Krieg sei den vertriebenen Schlesiern, Ostpreußen und Sudeten die eigene Opferrolle wichtiger gewesen. Es sei zu einer regelrechten "Opferrivalität" gekommen - wenn Juden das ehemalige Lager Föhrenwald besuchten, sei ihnen häufig die Tür gewiesen worden. Derweil verschanzten sich die Einheimischen hinter der Behauptung, Hitlers größtes Verbrechen sei die Verfolgung der katholischen Kirche gewesen und dass er den Krieg vom Zaun gebrochen hat.
Der Rest war Schweigen, komprimiert in der Formel "Das war halt so". Bis vor fünf Jahren ein Verein geschichtsbewusster Bürger den Erinnerungsort Badehaus in Waldram einrichtete, ein Museum in einem Gebäude, das einst als Mikwe diente. Alois Berger flankiert die Arbeit vor Ort, indem er Lokal- mit Weltgeschichte verknüpft und so dazu beiträgt, den blinden Fleck im Loisachtal auszuleuchten. HANNES HINTERMEIER
Alois Berger: "Föhrenwald, das vergessene Schtetl". Ein verdrängtes Kapitel deutsch-jüdischer Nachkriegsgeschichte.
Piper Verlag, München 2023. 240 S., Abb., geb.,
24,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main