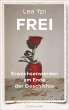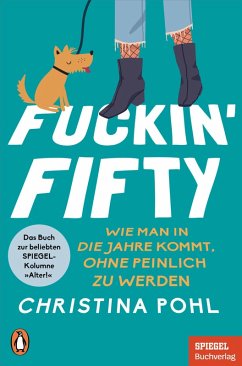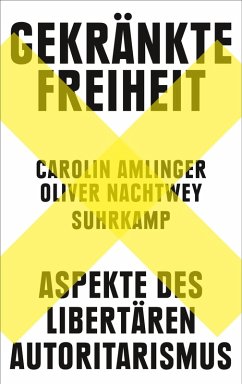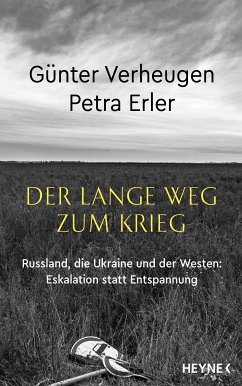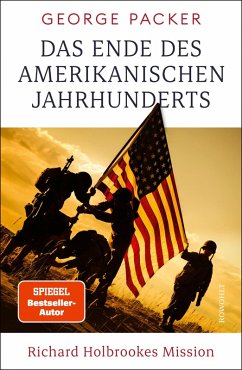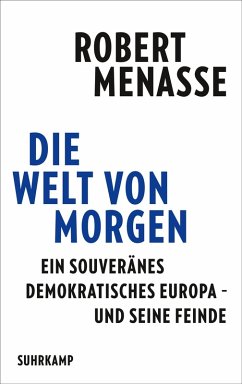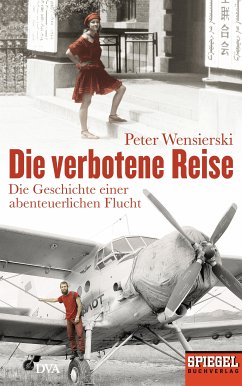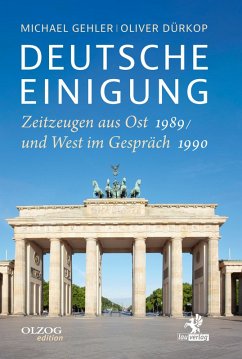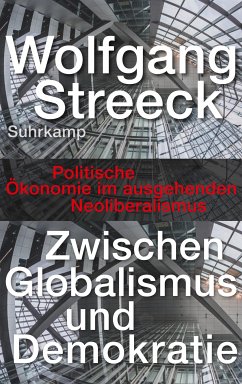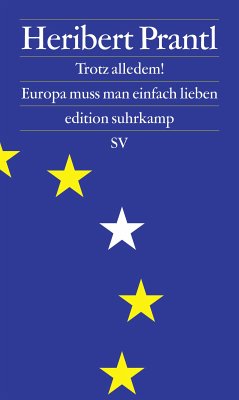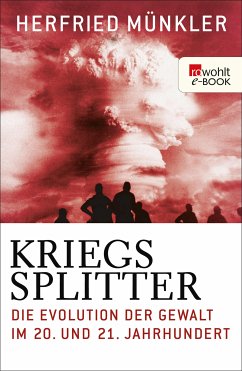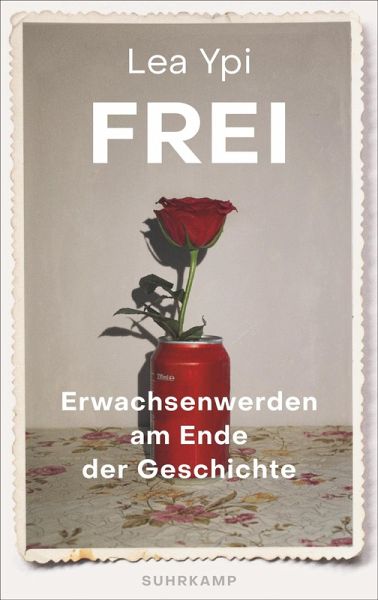
Frei (eBook, ePUB)
Erwachsenwerden am Ende der Geschichte Ein fesselndes Memoir über das poststalinistische Albanien
Übersetzer: Bonné, Eva
Sofort per Download lieferbar
Statt: 14,00 €**
13,99 €
inkl. MwSt.
** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Albanien 1989 - es herrschen Mangelwirtschaft, die Geheimpolizei und das Proletariat. Für die zehnjährige Lea ist dieses Land ihr Zuhause: ein Ort der Geborgenheit, des Lernens und der Hoffnung. Alles ändert sich, als die Mauer fällt. Jetzt können die Menschen wählen, wen sie wollen, sich kleiden, wie sie wollen, anbeten, was sie wollen. Aber die neue Zeit zeigt bald ihr hartes Gesicht: Skrupellose Geschäftemacher ruinieren die Wirtschaft, die Aussicht auf eine bessere Zukunft löst sich auf in Arbeitslosigkeit und Massenflucht. Das Land versinkt im Chaos, und Lea beginnt sich zu fragen...
Albanien 1989 - es herrschen Mangelwirtschaft, die Geheimpolizei und das Proletariat. Für die zehnjährige Lea ist dieses Land ihr Zuhause: ein Ort der Geborgenheit, des Lernens und der Hoffnung. Alles ändert sich, als die Mauer fällt. Jetzt können die Menschen wählen, wen sie wollen, sich kleiden, wie sie wollen, anbeten, was sie wollen. Aber die neue Zeit zeigt bald ihr hartes Gesicht: Skrupellose Geschäftemacher ruinieren die Wirtschaft, die Aussicht auf eine bessere Zukunft löst sich auf in Arbeitslosigkeit und Massenflucht. Das Land versinkt im Chaos, und Lea beginnt sich zu fragen, was das eigentlich ist: Freiheit.
In hinreißender Prosa erzählt die Autorin ergreifend über das Erwachsenwerden im poststalinistischen Albanien und in einer schillernden Familie, die vom Sturm der Geschichte erfasst wird.
In hinreißender Prosa erzählt die Autorin ergreifend über das Erwachsenwerden im poststalinistischen Albanien und in einer schillernden Familie, die vom Sturm der Geschichte erfasst wird.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.